Klaus
Pehl ![]() März 1998
März 1998
Neue TeilnehmerInnen an
Volkshochschul-Sprachkursen 1997
Auswertung einer Befragung
Abschlußbericht
Inhalt:
Stichprobe und Repräsentativität
Festlegung der Grundgesamtheit
Erwartete Zuverlässigkeit von Aussagen
Auswertbarer Stichprobenanteil
Repräsentativität auf der Ebene der TeilnehmendenErgebnisse zu einzelnen Merkmalen
Sozio-demographische Merkmale der Teilnehmenden
Andere Fremdsprachenkenntnisse
Zugang und Anlässe
Vorkenntnisse und Lernvorgeschichte
Lernumfeld
Gründe für die Wahl der Volkshochschule als Lernort
Fertigkeiten, Lernziele und Kompetenzen
Bewertung didaktischer Prinzipien
ZertifikateZusammenhänge zwischen ausgewählten Merkmalen
Geschlechtsspezifität von Ergebnissen
Altersspezifität von Ergebnissen
Lernvorgeschichte und Schulabschlüsse
Zusammenhang bei Lernabsichten
Zusammenhang von Anlässen und Zielen
Vergleich Alte und Neue LänderAnhänge
Anhang 1: Befragung neuer TeilnehmerInnen an VHS-Sprachkursen. Hinweise zur lokalen Grundauswertung
Anhang 2: Fragebogen - Beteiligungsquoten
Anhang 3: Untersuchung Sprachkursteilnehmende an VHS 1997. Bundesweite Kernstichprobe
Die Befragung von TeilnehmerInnen an Volkshochschul-Sprachkursen zielte global auf die Gewinnung einer Datenbasis für Marketing in Kooperation zwischen der Prüfungszentrale des DIE - seit 1.1.1998 WBT GmbH - und Verlagen von Sprachlernmedien sowie lokal auf die Gewinnung von Evaluationsdaten für die pädagogische Planung der beteiligten Volkshochschulen. Nach Eingang der Fragebogen und Einscannen in der Prüfungszentrale wurden in der Arbeitseinheit Information-Dokumentation-Kommunikation des DIE für jede Volkshochschule eine lokale Grundauswertung in Tabellenform mit Grafiken zur Verfügung gestellt und eine Lesehilfe (Anhang I) beigefügt. Rückmeldungen aus den lokalen Auswertungen zwischen Nov. 97 und Jan. 98 sind dem DIE nicht bekannt geworden. Insofern erfolgt in diesem Auswertungsbericht eine Konzentration auf die globalen Fragestellungen.
Untersuchungsphasen
Planung: Die Formulierung der Untersuchungsziele, die Planung der Befragung mit Abfassung des Fragebogens und die Vorerprobung an der Volkshochschule Dortmund erfolgte in der Arbeitsgruppe "Marketing" der Prüfungszentrale und ist nicht Gegenstands des Auswertungsberichts.
Durchführung: Bei der Planung der Befragung einer repräsentativen Stichprobe von neuen Teilnehmenden an Sprachkursen im Herbst 1997 stützte sich die Arbeitsgruppe "Marketing" auf die in einem Gutachten des DIE vorgeschlagene Stichprobe von 40 Volkshochschulen und beauftragte das Institut mit der Auswertung. Die 40 Volkshochschulen wurden angeschrieben und nach der Anzahl benötigter Fragebögen gefragt. Nicht alle Einrichtungen konnten eine Kooperation eingehen. Bei expliziten Absagen wurden in manchen Fällen Ersatzeinrichtungen gemäß der Gruppierung aller Volkshochschulen nach Repäsentativitätskriterien in einem Anhang des genannten Gutachtens gefunden. Diese Entscheidungen lagen bei der Prüfungszentrale.
Auswertung: Dem DIE liegen zur Auswertung insgesamt 3.251 Fragenbogenrückläufe von 29 Volkshochschulen vor. Neben einer Darstellung der Antworten der Teilnehmenden auf insgesamt 18 Fragenkomplexe und einer Erläuterung der statistischen Befunde wird der Auswertungsbericht auch auf die Diskussion mehrdimensionaler Zusammenhänge zwischen Untersuchungsmerkmalen gerichtet sein, insbesondere auf Schichtungen nach den einzelnen Fremdsprachen.
Die numerischen Ergebnisse sind für alle Fragenkomplexe des Fragebogens (Anhang K) zusammen mit den Beteiligungsquoten (Anhang J) differenziert nach belegten Fremdsprachen in Tabellenform mit wenigen Grafiken in den Anhängen (A) - (H) dokumentiert. Eine Bereitstellung einer elektronischen Datenbasis für weitergehende Untersuchungen durch die Fachwissenschaft über die hier dargestellten Ergebnisse ist möglich.
Stichprobe und Repräsentativität
Angesichts der Gesamtheit "Neue Teilnehmende an Sprachkursen", über die im Rahmen der globalen Fragestellung Informationen gewonnen werden soll, war nur eine stichprobenartige Befragung angemessen und durchführbar. Das DIE verfügt mit der Volkshochschul-Statistik über Daten, die eine fachwissenschaftlich gesicherte Konstruktion eines Stichprobenverfahrens zuließen.
Festlegung der Grundgesamtheit
Die Grundgesamtheit bestand als Untersuchungseinheiten aus allen TeilnehmerInnen an Volkshochschul-Sprachkursen, die zu Beginn des Arbeitsabschnitts Herbst 1997 "neu" in Kurse eintraten. Es ging um TeilnehmerInnen, denen das Lernmilieu Volkshochschule noch nicht vertraut war, von denen also unverfälschte Angaben zu ihrer Lernmotivation und ihren Lernerwartungen erwartet werden konnten.
Dieses Kriterium kann erst im Rahmen der Befragung selbst überprüft werden. Insofern ist die Grundgesamtheit fiktiv und Teil der für das Stichprobenverfahren relevanten Gesamtheit aller TeilnehmerInnen, die überhaupt zu Beginn des Arbeitsabschnitts Herbst 1997 in Kurse eintreten. Der Anteil der "Neuzugänge" wurde vorläufig auf der Basis des Erfahrungswissens von pädagogischem Planungspersonal mit etwa 15% geschätzt. Um 5.000 Fragebogen verteilen zu können, mußten demnach insgesamt Kurse mit etwa 33.000 TeilnehmerInnen in das Verfahren einbezogen werden.
Um einerseits Verfälschungen vorzubeugen, die dadurch entstehen könnten, daß in den einzelnen Volkshochschulen nur bestimmte Gruppen, z.B. nur aus Englischkursen, Berücksichtung finden, und um andererseits auch die lokalen Interessen an der Untersuchung zu berücksichtigen, war es sinnvoll, alle Untersuchungseinheiten einer Volkshochschule einzubeziehen. Das heißt, die lokale Volkshochschule fungiert als Erhebungseinheit, und es findet aus lokaler Sicht eine Vollererhebung aller "Neuzugänge" statt.
Der globalen Sicht bei der Untersuchung entspricht es, eine detaillierte Differenzierung nach einzelnen Bundesländern nicht in den Vordergrund stellen zu wollen, sondern gesamtbundesrepublikanische Fragestellungen zu erörtern. Allenfalls Fragestellungen zu den neuen Bundesländer insgesamt sollte nachgegangen werden können. Dem wurde entsprochen, indem (mit Ausnahme der Stadtstaaten Hamburg und Bremen mit nur einer bzw. zwei Volkshochschulen) jedes Bundesland mit mindestens einer Volkshochschule in der Stichprobenplanung vertreten ist. Es gibt allerdings einige Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein), in denen die Zahl der Einrichtungen überdurchschnittlich hoch ist und die Bandbreite von relativ kleinen bis zu relativ großen Einrichtungen reicht. Entsprechend mußten in diesen Ländern mehr als eine Volkshochschule in die Untersuchung Eingang finden.
Zusammenfassend konnte der Stichprobenumfang für die Untersuchungseinheiten, den "Neuzugängen" unter den TeilnehmerInnen, nicht vorgegeben werden, sondern bestimmte sich aus der Festlegung der Erhebungseinheiten, den Volkshochschulen, proportional zu ihrer Anzahl in den einzelnen Bundesländern. Der minimale Auswahlsatz mit diesen Eigenschaften für Volkshochschulen umfaßt 38 Volkshochschulen. Ihre Verteilung über die Bundesländer ist in Tabelle 1 wiedergegeben. In den Bundesländern Brandenburg, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde jeweils eine Volkshochschule ausgewählt. Die Stadtstaaten Hamburg und Bremen blieben unberücksichtigt, weil sie als große Volkshochschulen überproportional viele Untersuchungseinheiten (TeilnehmerInnen) in die Stichprobe eingebracht hätten. Länder mit großen Volkshochschulanzahlen wurden mehrfach berücksichtigt.
|
Tabelle
1: Verteilung der VHS als Erhebungseinheiten |
||
| Land |
Sollanzahl VHS |
Istanzahl VHS |
| Baden-Württemberg |
6 |
4 |
| Bayern |
7 |
6 |
| Berlin |
1 |
1 |
| Brandenburg |
1 |
2 |
| Bremen |
- |
- |
| Hamburg |
- |
- |
| Hessen |
1 |
- |
| Mecklenburg-Vorpommern |
1 |
1 |
| Niedersachsen |
3 |
3 |
| Nordrhein-Westfalen |
5 |
3 |
| Rheinland-Pfalz |
3 |
1 |
| Saarland |
1 |
- |
| Sachsen |
1 |
1 |
| Sachsen-Anhalt |
1 |
1 |
| Schleswig-Holstein |
6 |
5 |
| Thüringen |
1 |
1 |
| BRD |
38 |
29 |
Der Rücklauf zeigt, daß nicht nur wie geplant die Stadtstaaten Hamburg und Bremen in der Stichprobe nicht repräsentiert sind, sondern auch zusätzlich Hessen und das Saarland. Von daher ist eine Differenzierung nach einzelnen Bundesländern nicht möglich, was die Gesamtrepräsentativität nicht beeinträchtigen muß. VHS der neuen Länder sind wie geplant vertreten, so daß die Stichprobenlage eine besondere Analyse der Ergebnisse aus den neuen Ländern nicht unmöglich macht.
Orientierung für die Auswahl von Volkshochschulen innerhalb eines Bundeslands war die bundeslandspezifische mittlere Anzahl von Sprachbelegungen, die zum Zeitpunkt der Planung für 1995 vollständig statistisch erfaßt war. Es war nicht zu erwarten, daß in 1997 die Zahl der Belegungen in Sprachkursen beträchtlich von der bereits statistisch erfaßten von 1995 abweicht. Insofern war für den Herbst 1997 als Teilarbeitsabschnitt mit rund der Hälfte der Belegungen von 1995 zu rechnen. Aus der Zahl der auszuwählenden Volkshochschulen pro Bundesland und den landesspezifischen Durchschnitten ergab sich eine erwartete Belegungszahl mit einer für Herbst 1997 erwarteten Zahl von "neuen" TeilnehmerInnen gemäß Tabelle 2.
|
Tabelle 2: Erwartete und tatsächliche Stichprobengröße |
|||||
| Land |
Sollanzahl |
Mittlere Zahl der Bele-gungen pro VHS 1995 in Sprachkursen |
Erwartete "Neuzu -gänge" im Herbst 1997 |
Fragebogen -rückläufe |
Auwertbare Fragebögen |
| Baden-Württemberg |
6 (4) |
1.887 |
849 |
479 |
403 |
| Bayern |
7 (6) |
1.655 |
869 |
656 |
544 |
| Berlin |
1 (1) |
3.958 |
297 |
105 |
92 |
| Brandenburg |
1 (2) |
1.184 |
89 |
268 |
250 |
| Bremen |
- |
7.923 |
0 |
- |
- |
| Hamburg |
- |
31.452 |
0 |
- |
- |
| Hessen |
1 (-) |
4.308 |
323 |
- |
- |
| Mecklenburg-Vorpommern |
1 (1) |
819 |
61 |
29 |
29 |
| Niedersachsen |
3 (3) |
2.702 |
608 |
367 |
339 |
| Nordrhein-Westfalen |
5 (3) |
2.830 |
1.061 |
597 |
550 |
| Rheinland-Pfalz |
3 (1) |
1.012 |
228 |
46 |
45 |
| Saarland |
1 (-) |
1.792 |
134 |
- |
- |
| Sachsen |
1 (1) |
1.264 |
95 |
160 |
125 |
| Sachsen-Anhalt |
1 (1) |
968 |
73 |
141 |
134 |
| Schleswig-Holstein |
6 (5) |
512 |
230 |
136 |
125 |
| Thüringen |
1 (1) |
773 |
58 |
267 |
230 |
| BRD |
38 (29) |
1.789 |
4.976 |
3.251 |
2.866 |
Nach dem beschriebenen Verfahren war geplant, ca. 5.000 neue TeilnehmerInnen in die Untersuchung einzubeziehen. Dies ist - zum Vergleich - eine mit der im Berichtssystem Weiterbildung des BMBF verwendeten Zahl von 7.000 ähnliche Größenordnung.
Die Tatsache, daß die Gesamtzahl der 3.251 erfolgten Rückmeldungen 65,3% der erwarteten Anzahl von Neuzugängen ausmacht, ist für sich nicht ausreichend, um die Modellannahme von 15% Neuzugängen zu wiederlegen. In die Differenz gehen nämlich auch alle verhinderten Rückläufe von einem Teil der Volkshochschulen, von einem Teil der Kurse innerhalb einer Volkshochschule oder von einem Teil der Teilnehmenden eines Kurses ein. Gemessen an den Planungsvorgaben ist die Rücklaufquote als außerordentlich gut zu bezeichnen. Dies läßt auf ein hohes Eigeninteresse der beteiligten Multiplikatoren - Kursleitende einerseits und pädagogische Planungskräfte andererseits - schließen. Nur 88% der Rückläufe (2.866) sind in engerem Sinne für die Fragestellungen auswertbar. Dort haben Teilnehmende ihre Aussagen eindeutig auf eine belegte Sprache bezogen. Dieser Aspekt wird später ausführlicher untersucht.
Stichprobenplanung und Repräsentativität auf Einrichtungsebene
Schon aus der Erörterung des nach dem vorgeschlagenen Verfahren zu erwartetenden Stichprobenumfangs geht hervor, daß als eines der Repräsentativitätskriterien die
- Bundeslandzugehörigkeit
galt. Darüber hinaus hatte das Verfahren die
- Größenordnung der zu erwartenden Belegungszahl
in den einzelnen Volkshochschulen zu berücksichtigen. In den Bundesländern mit nur einer Volkshochschule war diejenige Volkshochschule ausgewählt, deren Belegungszahl 1995 am nächsten dem Landesdurchschnittswert kommt. In den Ländern mit mehr als einer Volkshochschule sind weitere Volkshochschulen so ausgewählt worden, daß die Volkshochschulbereiche über dem Mittelwert bzw. unterhalb des Mittelwerts der Belegungszahlen 1995 gleichmäßig aufgeteilt sind.
|
Tabelle 3: Stichprobe Erhebungseinheiten Volkshochschulen |
|||||||
| Volkshochschule in |
U.-Stunden Sprachen 1995 |
Belegungen Sprachen 1995 |
Anteil Sprachen- |
Einwohner
Versorgungs- |
"regional arbeitend" [R] |
Anteil Englisch- |
Anteil
DaF-Bele- |
|
Schleswig-Holstein |
|||||||
| Schacht-Audorf |
80 |
46 |
7,4% |
4.193 |
83% |
0% |
|
| Plön |
1.164 |
496 |
31,4% |
12.283 |
36% |
5% |
|
| Uetersen |
1.082 |
516 |
29,9% |
21.863 |
61% |
6% |
|
| Trittau |
1.452 |
695 |
28,2% |
6.731 |
59% |
9% |
|
| Rendsburg |
3.803 |
1.639 |
25,8% |
52.645 |
48% |
5% |
|
|
Niedersachsen |
|||||||
| Norden |
13.269 |
1.511 |
20,25% |
87.992 |
R |
32% |
21% |
| Einbeck |
9.630 |
2.703 |
25,75% |
154.200 |
R |
43% |
11% |
| Barsinghausen |
9.342 |
4.072 |
31,52% |
91.386 |
45% |
6% |
|
|
Nordrhein-Westfalen |
|||||||
| Overath |
4.378 |
1.819 |
24,75% |
49.248 |
42% |
3% |
|
| Lüdenscheid |
6.366 |
2.846 |
39,88% |
81.155 |
36% |
15% |
|
| Moers |
12.665 |
4.930 |
38,20% |
175.209 |
37% |
13% |
|
|
Rheinland-Pfalz |
|||||||
| Cochem |
6.142 |
1.009 |
27,65% |
64.879 |
R |
29% |
23% |
|
Baden-Württemberg |
|||||||
| Titisee-Neustadt |
2.618 |
908 |
16,86% |
43.414 |
34% |
5% |
|
| Herrenberg |
5.395 |
1.837 |
10,70% |
68.167 |
39% |
10% |
|
| Offenburg |
7.810 |
1.949 |
27,78% |
55.316 |
36% |
11% |
|
| Bruchsal |
6.151 |
2.831 |
26,88% |
154.585 |
40% |
9% |
|
|
Bayern |
|||||||
| Eching |
2.204 |
715 |
15,96% |
15.463 |
47% |
5% |
|
| Kitzingen |
3.186 |
987 |
19,87% |
47.678 |
33% |
9% |
|
| Schwabach |
3.100 |
1.656 |
32,73% |
37.575 |
37% |
1% |
|
| Forchheim |
5.452 |
2.110 |
16,38% |
108.949 |
R |
44% |
5% |
| Pullach |
7.404 |
2.756 |
27,71% |
16.042 |
34% |
3% |
|
|
Berlin |
|||||||
| Berlin-Charlottenb. |
16.160 |
3.979 |
31,05% |
181.472 |
22% |
40% |
|
|
Brandenburg |
|||||||
| Senftenberg |
8.596 |
1.684 |
34,67% |
158.537 |
R |
81% |
8% |
| Belzig |
7.997 |
1.797 |
36,07% |
175.766 |
R |
79% |
4% |
|
Mecklenburg-Vorpommern |
|||||||
| Parchim |
3.712 |
817 |
24,89% |
106.629 |
R |
60% |
16% |
|
Sachsen |
|||||||
| Radebeul |
3.706 |
1.244 |
50,51% |
103.548 |
85% |
2% |
|
|
Sachsen-Anhalt |
|||||||
| Wanzleben |
8.921 |
965 |
29,98% |
81.106 |
R |
56% |
35% |
|
Thüringen |
|||||||
| Eisenach |
4.571 |
1.274 |
54,87% |
114.430 |
R |
72% |
13% |
Die Stichprobe wurde mit dem oben beschriebenen Konstruktionsverfahren gewonnen, was erlaubt, die Relationen zu weiteren Repräsentativitätskriterien mit Hilfe der statistischen Datenbasis im DIE anzugeben.
Die Volkshochschulen der Stichprobe (Werte der geplanten Stichprobe in Klammern) repräsentieren:
- 2,9% (3,4%) aller Volkshochschulen
- 3,3% (4,2%) aller Kurse, 3,7% (4,3%) aller Unterrichtsstunden und 3,2% (4,1%) aller Belegungen
- 3,5% (4,1%) der Sprach-Unterrichtsstunden und 3,2% (4,0%) aller Sprach-Belegungen
- 3,4% (4,1%) aller Englisch-, 3,3% (4,5%) aller Französisch-, 3,0% (4,3%) aller Italienisch, 2,8% (3,6%) aller Russisch-, 3,3% (4,3%) aller Spanisch-Belegungen
- 2,8% (3,3%) aller DaF-Belegungen und 2,8% (3,3%) aller Belegungen Deutsch für Deutsche
- in ihren Versorgungsgebieten 3,3% (3,9%) aller Einwohner
- 3,8% (4,9%) der regional arbeitenden Volkshochschulen.
Trotz des vereinfachten Auswahlverfahrens, welches nur die Anteile der VHS in den Bundesländern sowie die Belegungszahl in Sprachkursen berücksichtigt, wird auch in wichtigen anderen Dimensionen brauchbare Repräsentativität erreicht, wie an den nahe beieinanderliegenden Quoten zu erkennen ist. Die Ausfälle im Rücklauf führten zu einer Minderung der Auswahlsätze von weniger als einem Prozentpunkt, was nur geringfügige Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit von verallgemeinernden Aussagen hat, aber nicht die Repräsentativität beeinträchtigt.
Erwartete Zuverlässigkeit von Aussagen
Mit knapp 3.000 Untersuchungseinheiten, d.s. ca. 3,2% der Gesamtheit, ist bei Extrapolation von Anteilswerten in der Stichprobe auf Anteilswerte in der Grundgesamtheit mit einer hohen Treffsicherheit im Bereich von +/- 2% bei einer statistischen Sicherheit von 99% zu rechnen.
- Rücklauf von 3.251 Fragebogen
Nicht alle der 3.251 eingegangenen Fragebögen lassen sich für die Fragestellung sinnvoll auswerten. Das liegt daran, daß der Frage "Für welche Fremdsprache haben Sie jetzt einen Kurs belegt?" (Frage 6) für die meisten der folgenden Fragen eine strukturierende Schlüsselfunktion zukommt.
- 3,7% Mehrfachbelegungen
Weder die Verwendung des Singulars noch das Fehlen der Anmerkung "Mehrfachnennungen möglich", die an anderen Stellen im Fragebogen angebracht ist, hat dazu geführt, daß Teilnehmende nicht mehr als eine Sprache als "belegt" deklariert haben. Das aber ist die Voraussetzung, um den Antworten auf weitere Fragen einen direkten oder indirekten inhaltlichen Bezug zu geben. Ein Beispiel für einen direkten Bezug ist die Frage nach der beabsichtigten Lernzeit für "diese Sprache" (Frage 13). Aber auch die Fragen nach der wichtigsten Fertigkeit (Frage 15) oder nach der Bedeutung einer Auswahl von Lernzielen (Fragenkomplex 16) machen nur einen Sinn, wenn sie auf eine konkrete Sprache bezogen werden. Denn verschiedene Sprachen können in der Lebenswelt der Lernenden höchst unterschiedliche Rollen spielen. Daher werden die 118 Teilnehmenden, die zwei Fremdsprachen als belegt angegeben haben, die vier Teilnehmenden, die drei Fremdsprachen belegt haben, sowie ein Teilnehmer, der sogar vier Fremdsprachen gleichzeitig belegt hat, also insgesamt 123 Teilnehmende (3,7%), nicht in den Kern der Auswertung miteinbezogen.Die Analyse der Mehrfachangaben zeigt durchaus schlüssige Kombinationen von Fremdsprachen. In den meisten Fällen gehört mindestens eine "große" europäische Fremdsprache zu dem Belegungsmuster, häufig sogar zwei: Der vierfache Sprachenlerner widmet sich gleichzeitig Englisch, Französisch, Italienisch und Neugriechisch. Die dreifach Lernenden kombinieren Englisch und Französisch in zwei Fällen mit Italienisch und in einem Fall mit Spanisch. Dänisch, Italienisch und Schwedisch ist die vierte Dreierkombination. Unter den Zweierkombinationen sind die häufigsten
Englisch – Französisch (43)
Englisch – Spanisch (20)
Englisch – Italienisch (13)
Französisch – Italienisch (13)
Englisch – Deutsch (9)
Französisch – Spanisch (7)
Italienisch – Spanisch (5)
- 8,1% ohne Angabe zur belegten Sprache
Nicht auswertbar sind auch die Rückmeldungen der 262 Teilnehmenden, die keine Angabe zu einer belegten Sprache machen. In der Analyse der anderen Angaben dieser Gruppe zeigt sich ein aufschlußreiches Phänomen. Es gibt offensichtlich eine Gruppe von Teilnehmenden, die im Grundsatz dem Ansinnen von Fragebögen skeptisch gegenübersteht. Zwar entschließen sie sich nicht, den Fragebogen im ganzen nicht zu bearbeiten (insofern darf man sie keineswegs für unkooperativ halten), aber insbesondere die Beantwortung der ersten vier Fragen nach dem Geschlecht, nach "Ausländern" (nicht Muttersprache Deutsch), nach dem Alter und dem Schulabschluß, also eine kleine Auswahl sozio-demographischer Daten, wird in Verbindung mit der belegten Sprache möglicherweise als zu klassifizierend oder zu identifizierend empfunden. Die allgemeine Zusicherung der "guten Absicht" der Volkshochschule, das Angebot im Fremdsprachenunterricht verbessern zu wollen, und die Zusicherung, Datenschutzbestimmungen durch anonyme Auswertung einzuhalten, ist für diese Gruppe nicht ausreichend überzeugend. Vielleicht geht es ihr auch darum, beim lebenslangen Lernen nicht lebenslange Spuren zu hinterlassen.
Aufgrund dieser Überlegungen wäre anzunehmen, daß der Anteil von Volkshochschule zu Volkshochschule nur zufällig um den Durchschittswert von 8,1% schwankt. Die Stichprobenergebnisse machen aber weitere Einflußfaktoren deutlich, denn von den insgesamt 29 Volkshochschulen liegen 7 deutlich über 10% bis hin zu 30%. Das heißt, daß die spezifische Art der Präsentation der Einrichtungen von solchen Evaluationsbemühungen auch spezifische Auswirkungen auf die Beteiligung hat. Aus der Annahme heraus, daß die Reihenfolge beim Rückversand der Fragebögen in etwa die Zusammengehörigkeit von Kursen widerspiegelt, kann auch auf Möglichkeiten der Beeinflußung durch Kursleitende oder auf die "ansteckende" Wirkung von Fragebogenskepsis in der Lerngruppe geschlossen werden. Es sind oft große Gruppen in einzelnen Kursen, die sich bei der Beantwortung der ersten sechs Fragen zurückgehalten haben.
Bei jeweils rund drei Viertel der Gruppe ohne Angaben zu einer Sprache fehlen auch die Angaben zu Geschlecht, Alter und Muttersprache. Am höchsten ist der Anteil bei der Frage nach der Muttersprache. Da die Deutschkurse in der Stichprobe im Vergleich zum bundesweiten Anteil 1996 deutlich unterrepräsentiert sind, darf angenommen werden, daß es besonders Ausländer sind, die in der Beantwortung dieser Frage Zurückhaltung üben.
- Reduktion der Stichprobe auf 2.866 Teilnehmende
Bei der Auswertung der zentralen Fragen zum Fremdsprachenlernen an Volkshochschulen werden beide Gruppen, die Teilnehmenden ohne Angaben zu der belegten Fremdsprache (262) sowie die mit Mehrfachangaben (123) nicht mit einbezogen. Es verbleiben 2.866 Teilnehmende aus 29 Volkshochschulen. Deren Angaben können trennscharf nach den einzelnen Fremdsprachen differenziert werden. Für die meisten tabellarischen Darstellungen von Ergebnissen wird diese Differenzierung gewählt.
Repräsentativität auf der Ebene Teilnehmenden
Der Vergleich von Ergebnissen in der Stichprobe mit bekannten Befunden für die Gesamtheit aller Sprachkursteilnehmenden ist die Grundlage zu beurteilen, für wie repräsentativ die Stichprobe auf der Ebene der Untersuchungseinheiten, also der Teilnehmenden, gelten kann. Hierfür stehen nur wenige Merkmale zur Verfügung.
- Geschlechtsverteilung identisch
Mit 69,7% ist der Frauenanteil in der Stichprobe nahezu identisch mit dem für 1996 ermittelten Anteil von 69,0% aller Teilnehmenden von Sprachkursen.
- Altersverteilung befriedigend repräsentativ
Die Altersgruppe der 35- bis unter 50jährigen ist mit 36,5% in der Stichprobe im Vergleich zu dem für 1996 insgesamt festgestellten Anteil von 29,9% merklich überrepräsentiert. Dafür sind die benachbarte Gruppe der 25- bis unter 35jährigen mit 26,3% in der Stichprobe im Vergleich zu 30,2% wie auch die älteste der Gruppe ab 65 Jahren mit 2,7% in der Stichprobe im Vergleich zu 5,8% in der Gesamtheit von 1996 unterrepräsentiert. Bei allen anderen Altersgruppen übersteigt der Unterschied zwischen Stichprobe und Gesamtheit einen Prozentpunkt nicht.
- Fast alle Bundesländer vertreten
Neben den Stadtstaaten Hamburg und Bremen fehlen Rückläufe von nur zwei weiteren Bundesländern. Die Verteilung der Belegungen 1996 und der Rückläufe innerhalb der vertretenen Bundesländer zeigt, daß der Anteil von Niedersachsen in der Stichprobe exakt getroffen ist. Alle weiteren alten Bundesländer sind leicht unterrepräsentiert, am stärksten Baden-Württemberg (6 Prozentpunkte Differenz). Alle neuen Länder sind leicht überrepräsentiert, am stärksten Brandenburg (7 Prozentpunkte Differenz). Dies hat sich schon angedeutet beim Vergleich der erwarteten Zahl der Neuzugänge und den tatsächlichen Rückläufen (vgl. Tabelle 2).
- TeilnehmerInnen an Deutschkursen unterrepräsentiert
Befragt wurden auch Teilnehmende an Kursen Deutsch als Fremdsprache. Es war nicht geplant, Kurse Deutsch als Muttersprache in die Untersuchung einzubeziehen. Trotzdem gaben 9,6% der Teilnehmenden an Deutschkursen als Muttersprache Deutsch an. In jedem Fall sind Deutschkursteilnehmende mit 5,9% in der Stichprobe im Vergleich zu 13,8% Teilnehmenden an Kursen Deutsch als Fremdsprache in der Gesamtheit 1996 deutlich unterrepräsentiert. Dies verwundert nicht, da die 90% Ausländer im Sinne einer nichtdeutschen Muttersprache mit einem deutschen Fragebogen konfrontiert gewesen waren.
- Verteilung über große Fremdsprachen repräsentativ
Nur für die "großen" Fremdsprachen ist ein Vergleich der Stichprobenanteile mit der Gesamtheit 1996 der Teilnehmenden ergiebig. Sieht man von Deutsch ab, ergibt sich eine gute Übereinstimmung. Englisch und Spanisch sind geringfügig überrepräsentiert (jeweils 2 Prozentpunkte Differenz), während Französisch und Italienisch leicht unterrepräsentiert sind (4 bzw. 1 Prozentpunkte Differenz). Alle "kleinen" Fremdsprachen, die in der Gesamtheit 1996 nur 5.000 oder weniger Belegungen aufweisen, sind auch in der Stichprobe vertreten. Ein genauer Vergleich wäre aufgrund der kleinen Anteile zu unzuverlässig. Insgesamt kann die Verteilung - von Deutsch abgesehen - als ein getreues Abbild der Verteilung der Belegungen von 1996 gelten.
Zwischenresümee: Verallgemeinernde Aussagen sind zulässig
- Auch VHS-erfahrene Teilnehmende erreicht
Im Durchschnitt hat knapp ein Drittel der Teilnehmenden angegeben, schon einmal einen Sprachkurs an der Volkshochschule belegt zu haben. Damit ist zwar das Untersuchungsziel, sich möglichst auf unverfälschte Angaben zur Lernmotivation und den Lernerwartungen berufen zu können, erreicht. Zurecht wird aber im weiteren Verlauf allgemein von Teilnehmenden und nur dann von neuen Teilnehmnden gesprochen, wenn die Untergruppe derjenigen gemeint ist, die die entsprechende Frage verneint haben. Dabei können die 118 Teilnehmenden, die die Frage überhaupt nicht beantwortet haben, dazugerechnet werden.
Ergebnisse zu einzelnen Merkmalen
Alle Ergebnisse zu den einzelnen Untersuchungsmerkmalen werden in diesem Abschnitt nach der belegten Fremdsprache differenziert erörtert. Der Auswertung im Hinblick auf Zusammenhänge zwischen weiteren ausgewählten Merkmalen ist ein eigener Abschnitt gewidmet.
Sozio-demographische Merkmale der Teilnehmenden
- Frauenanteil schwankt zwischen 20% und 79%
Der Frauenanteil insgesamt liegt bei 69,7% und ist damit kleiner als beispielsweise im Programmbereich Kultur - Gestalten, aber größer als in den Kernbereichen der beruflichen Bildung (Programmbereich Arbeit - Beruf). Merkliche Abweichungen treten nur bei den "kleinen" Sprachen auf. Bei den "großen" Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch liegen die Frauenanteile eher über dem Durchschnitt, alle im Bereich zwischen 69,0% und 75,3%. Daraus ist nicht der Schluß zu ziehen, daß die "kleinen" Sprachen eher eine Domäne der Männer ist. Auch hier sind die Frauenanteil mit Ausnahmen von Portugiesisch (20%) und Tschechisch (25%) nahe um den Durchschnittswert verteilt.
- Teilnehmende von Deutsch-Kursen am jüngsten - von Ungarisch-Kursen am ältesten
Die Altersverteilung entspricht den Erwartungen aus den Ergebnissen, die aus der Volkshochschul-Statistik bekannt sind. Für eine Differenzierung nach Sprachen geben die jeweiligen Altersdurchschnitte einen Anhaltspunkt. Deutsch als Fremdsprache spielt offensichtlich eine Sonderrolle. Insgesamt fällt auf, daß unter den "großen" Sprachen die klassischen Erst- und Zweitsprachen der Schulausbildung Englisch und Französisch höhere Altersdurchschnitte aufweisen als die klassischen Drittsprachen Spanisch und Italienisch. Bei den "kleinen" Sprachen wären weitgehende Interpretationen überzogen, da bei ihnen nur relativ kleine absolute Zahlen vorliegen, im Fall von Arabisch nur 2 Teilnehmende.
Neben dem Durchschnitt ist auch die Streuung der Altersverteilungen ein wichtiger Aspekt. Sie kennzeichnet die Altershomogenität. So kann bei Türkisch-Teilnehmenden von einer vergleichsweisen jungen Gruppe gesprochen werden, während bei Norwegisch zwar der Altersdurchschnitt relativ hoch ist, aber die Gruppe gleichzeitig eine relativ hohe Streuung aufweist. Unter dem Gesichtspunkt der Öffentlichkeitsarbeit stellen sich angesichts der verschiedenen Besetzungen der Gruppen die Fragen, ob in der Bevölkerung die Gruppen angesprochen werden sollen, die unter den Teilnehmenden bisher unterdurchschnittlich besetzt sind, oder verstärkt die starken Gruppen, weil eine Belegung dort wahrscheinlicher ist.
|
Tabelle 4: Durchschnitt und Streuung der Altersverteilungen |
||
|
Sprache |
Altersdurchschnitt |
Streuung |
|
Deutsch |
27,7 |
12,8 |
|
andere Sprache |
29,1 |
11,9 |
|
Türkisch |
32,7 |
8,3 |
|
Polnisch |
33,9 |
17,3 |
|
Tschechisch |
34,8 |
13,2 |
|
Spanisch |
35,0 |
13,2 |
|
Italienisch |
35,4 |
11,5 |
|
Schwedisch |
35,6 |
13,2 |
|
Russisch |
36,5 |
16,4 |
|
Dänisch |
36,6 |
10,6 |
|
Neugriechisch |
37,5 |
11,9 |
|
Französisch |
38,2 |
14,5 |
|
Englisch |
39,2 |
12,7 |
|
Portugiesisch |
39,4 |
13,0 |
|
Norwegisch |
39,7 |
16,9 |
|
Niederländisch |
41,3 |
15,2 |
|
Ungarisch |
41,5 |
12,3 |
|
Arabisch |
43,0 |
14,7 |
|
zusammen |
37,2 |
12,9 |
- Teilnehmende mit Mittlerer Reife am häufigsten
Die Scheu der Untersucher, die Schulabschlüsse der Teilnehmenden in einer eindeutigen Rangordnung zusammen mit der Frage nach dem höchsten Schulabschluß zu präsentieren, ist verständlich. Die Eröffnung der Möglichkeit, mehrere Schulabschlüsse oder etwa alle erreichten zu markieren, ist nicht häufig und unsystematisch genutzt worden. Deswegen ist das vom Fragebogen her häufbare Merkmal Schulabschluß für die Auswertung in ein nicht häufbares Merkmal mit gegenseitig ausschließenden Ausprägungen im Sinne des erreichten weitreichendsten Abschlusses umgerechnet.
Bei der Differenzierung nach Sprachen zeigt sich, daß bei Niederländisch, Arabisch, Neugriechisch, anderen Sprachen, Dänisch, Spanisch, Türkisch, Französisch, Norwegisch, Russisch und Englisch sich die Teilnehmenden mit Mittlerer Reife häufen, und zwar bei Niederländisch am stärksten und bei Englisch am geringsten. Bei Schwedisch, Deutsch als Fremdsprache, Ungarisch und Tschechisch sind Abiturienten die stärkste Gruppe, besonders ausgeprägt bei Tschechisch. Bei Russisch, Italienisch, Polnisch und Portugiesisch sind auch Teilnehmende mit universitären Abschlüssen stark vertreten.
Andere Fremdsprachenkenntnisse
- Neben großer Vielfalt Konzentration auf die schulischen Erstsprachen
Nicht alle Teilnehmenden haben zwischen Vorkenntnissen in der belegten Sprache (Frage 8) und Kenntnissen in anderen Fremdsprachen unterschieden. Auch der Vorfilter zu Kenntnissen in Fremdsprachen ("Nein", "Ja, und zwar in ...") war wenig ergiebig (Beginn Frage 9). Die Anteile für die einzelnen Sprachen ähneln ihren Belegungsanzahlen in der Gesamtheit 1996. Spitzenreiter sind natürlich die klassischen schulischen Erstsprachen Englisch und Französisch in den alten Ländern und Russisch in der ehemaligen DDR. Der Anteil für Deutsch ist einmal durch Nichtmuttersprachler Deutsch, die andere Fremdsprachen belegt haben und auch Deutschkenntnisse besitzen, erklärt, zum anderen durch den relativ hohen Anteil der Teilnehmenden bei Deutsch, die nicht zwischen der belegten und (davon verschiedenen) anderen Fremdsprachen unterschieden haben.
|
Tabelle 5 |
|
|
Sprache |
Anteil in % |
| Englisch |
45,2 |
| Französisch |
22,4 |
| Russisch |
21,4 |
| Deutsch |
7,2 |
| Italienisch |
4,6 |
| Spanisch |
4,2 |
| Polnisch |
1,8 |
| Türkisch |
1,4 |
| Niederländisch |
0,9 |
| Dänisch |
0,7 |
| Portugiesisch |
0,7 |
| Schwedisch |
0,6 |
| Griechisch |
0,6 |
| Ungarisch |
0,6 |
| Tschechisch |
0,5 |
| Arabisch |
0,2 |
| Norwegisch |
0,1 |
In der Differenzierung nach einzelnen Sprachen treten neben Häufungen bei den dominanten Erstfremdsprachen Englisch, Französisch und Russisch Häufungen bei weiteren interessanten (Zweier-)Kombinationen von belegter Sprache und Kenntnissen in einer weiteren Sprache zutage. Die auffälligsten sind:
- Norwegisch belegt - Kenntnise in Dänisch
- Polnisch belegt - Kenntnisse in Italienisch bzw. in Schwedisch
- Deutsch belegt - Kenntnisse in Polnisch bzw. in Türkisch
- Neugriechisch belegt - Kenntnisse in Ungarisch
- Weiterbildung hat starken Bezug zur zweiten Fremdsprache
Die Rubrik "andere Fremdsprachen" wurde von den Teilnehmenden offensichtlich nicht als "Restkategorie" nicht genannter kleiner Sprachen verstanden, sondern pauschal. Der hohe Anteil von 66% der Teilnehmenden belegt noch einmal nachdrücklich, wie stark sich Fremdsprachenlernen bei den Muttersprachlern Deutsch auf Zweitfremdsprachen bezieht.
- Volkshochschulerfahrung bei einem Drittel der Teilnehmenden
Für keine Sprache gibt es Teilnehmerschaften ohne zumindest Teilgruppen mit Volkshochschulerfahrung. Diese Aussage nur auf die Volkshochschule einzuschränken, an der der Fremdsprachenkurs zur Zeit belegt ist, ist vermutlich überzogen (Frage 5 "... an unserer VHS ..."). Kleine sprachliche "Finessen" wurden von den Teilnehmenden häufig "überlesen". Die anschließende Tabelle gibt die einzelnen Sprachen nach der Häufigkeit der Volkshochschulerfahrung wieder.
|
Tabelle 6: Volkshochschulerfahrung |
|
|
Sprache |
Bereits Sprachkurs an VHS |
|
% |
|
| Russisch |
66,7 |
| Norwegisch |
59,1 |
| Arabisch |
50,0 |
| Dänisch |
46,7 |
| Französisch |
44,9 |
| Tschechisch |
42,9 |
| andere Sprache |
42,9 |
| Neugriechisch |
36,8 |
| Spanisch |
33,6 |
| Italienisch |
31,7 |
| Englisch |
28,2 |
| Niederländisch |
27,8 |
| Deutsch |
27,1 |
| Schwedisch |
25,6 |
| Polnisch |
25,0 |
| Portugiesisch |
21,4 |
| Türkisch |
18,5 |
| Ungarisch |
13,9 |
| insgesamt |
31,7 |
- Nur ein Fünftel vor der Belegung in direktem Kontakt mit der Volkshochschule
Die Frage nach den Grundlagen der Belegung war offensichtlich so strukturiert, daß trotz der Möglichkeit zur Mehrfachnennung Teilnehmende sich höchstens für eine Möglichkeit entschieden haben. Insofern ergibt sich eine eindeutige (nicht häufbare) Verteilung. Die "Selbsteinstufung" galt als Platzhalter dafür, daß aus Sicht der Teilnehmenden keine besonderen inhaltlich bestimmten Prozeduren wie (telefonisches) Beratungsgespräch (oder Einstufungstest) für die Belegungen notwendig waren. Es ist an der Rubrik "andere Grundlagen" nicht zu erkennen, ob sich Einstufungsverfahren dahinter verbergen. Das wäre durchaus plausibel, da es sich in vielen Fällen nicht um Anfänger und neue Teilnehmende für die belegte Fremdsprache handelt. Mit 13% ist immerhin eine intensive persönliche Kontaktaufnahme durch die Einrichtung signalisiert. Mit Abstand am relativ häufigsten findet ein Beratungsgespräch bei Deutsch, also bei der Betreuung von Nichtmuttersprachlern Deutsch statt. Während bei dem Beratungsgespräch noch die "großen" Sprachen besonders häufig sind, fallen sie unter den Fällen telefonischer Beratung gegenüber den "kleinen" Sprachen nicht auf.
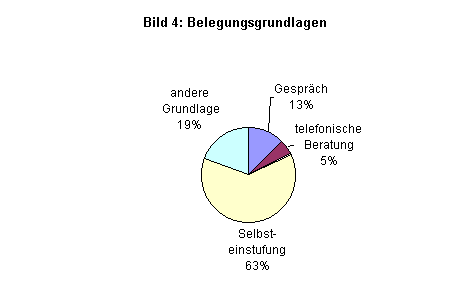
- Reisepläne häufigster Belegungsanlaß
Unter den angebotenen Anlässen hat "Erweiterung der Allgemeinkenntnisse" als eine Art Platzhalter für nicht näher benennbare Anlässe über die Hälfte der Teilnehmenden (54%) angezogen. Als spezifischer, aber immer noch abstrakt mit Platzhalterwirkung kann allgemeines Sprachinteresse (26%) gelten. Konkretere Anlässe oder auch Motive mit besonderer Häufung sind Reisepläne (40%), Interesse für das Land, in dem die Sprache gesprochen wird (36%) und Fremdsprachenlernen als sinnvolle Freizeitbeschäftigung (34%). Sozio-kulturelle Spezifikationen dieses personenbezogenen Komplexes wie kulturelles Interesse (11%) oder familiäre Gründe (13%), auf die Verwendung der Fremdsprache bezogen, sowie Kontakt mit Menschen mit ähnlicher Interessenlage (11%), auf den Prozeß des Lernens selbst bezogen, finden in etwa in der gleichen Größenordnung Zustimmung. Dazwischen liegen die arbeits- und berufsbezogenen Anlässe: "dringlich" Notwendigkeit am Arbeitsplatz (18%) und "vorsorglicher" Vorteile bei Bewerbungen (17%).
Um die Bedeutung beruflicher Gründe zu analysieren, wäre es wichtig, vor allem auch Zeitvergleiche heranzuziehen. In der Diskussion von ErwachsenenbildnerInnen nimmt der Berufsbezug beim Fremdsprachenlernen größeren Raum ein. Ein Ergebnis aus einer Untersuchung des DIE zur Beruflichen Bildung (Pehl 1995) zeigt auf der Basis von 1994 - neuere Untersuchungen stehen nicht zur Verfügung -, daß mit mindestens 3,6% explizit als berufsbezogen geplanten Fremdsprachenkursen (für Deutsch als Fremdsprache sogar mit 5%) zu rechnen sind. Die vorliegende Untersuchung von Teilnehmenden an Fremdsprachenkursen macht aber deutlich, wie sehr offensichtlich aus der persönlichen Sicht von Teilnehmenden auch der Berufsbezug von Bedeutung in solchen Kursen ist, die nicht vorwiegend berufsbezogenen Lernziele verfolgen.
Dem Interesse für das Land kommt durch die Differenzierung nach Sprachen eine noch gestärkte Bedeutung zu, denn mit Abstand der niedrigste Wert (15%) bei Englisch, als Universalsprache im Landesbezug mehrdeutig (USA, Indien usw.), drückt das bereits genannte Gesamtergebnis nach unten. Werte um 60% oder darüber erreichen die Sprachen Griechisch (100%, also alle 38 Teilnehmenden), Tschechisch (90%), Dänisch (81%), Norwegisch (73%), Italienisch (70%), Schwedisch (68%), Niederländisch (67%), Portugiesisch (63%), Polnisch (62%) und Russisch (58%).
Der hoch bewertete Anlaß Reisepläne weist bezüglich der einzelnen Länder, die hinter den Sprachen stehen, eine beträchtliche Streuung auf.
|
Tabelle 7: Länder mit Belegungsanlaß Reisepläne |
|
|
Land |
Reisepläne |
|
Dänemark |
57,4 |
|
Spanien (+ Lateinamerika) |
57,1 |
|
Tschechien |
55,6 |
|
Norwegen |
54,5 |
|
Schweden |
54,5 |
|
Portugal (+Brasilien) |
50,0 |
|
Griechenland |
47,4 |
|
Polen |
46,2 |
|
Ungarn |
43,6 |
|
Italien |
40,6 |
|
England + USA |
38,1 |
|
Frankreich |
35,8 |
|
Türkei |
29,6 |
|
Niederlande |
27,0 |
|
Rußland |
26,3 |
Die klassischen südlichen Urlaubsländer liegen keineswegs an der Spitze, allerdings Spanien, Portugal und Griechenland vor dem eher im Durchschnitt liegenden Italien. Reisepläne häufen sich auch in Ländern Nordeuropas sowie Osteuropas. Die Länder der "großen" Sprachen England (mit USA) und Frankreich verursachen den im Vergleich relativ niedrigen Gesamtanteil.
- Nur 2% der Teilnehmenden bereits von Beginn an mit Prüfungsabsicht
Aus Sicht der Aufgabe der Einrichtung, die diese Untersuchung veranlaßt hat, die Prüfungszentrale des DIE/DVV, ab 1.1.1998 Weiterbildung-Testsysteme GmbH, eröffnet sich ein großes Feld für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der hohen 98% der Teilnehmenden, die Prüfungsabsicht nicht zu ihren Lernanlässen zählen. Öffentlichkeitsarbeit kann sich einmal vorsorglich an die Bevölkerung (noch) außerhalb der Volkshochschulen wenden. Zum anderen wird sie die Kursteilnehmenden im Verlauf des Lernprozesses in den Blick nehmen, um sie vom Sinn lernzielorientierter Qualifikationsnachweise zu überzeugen. Vor allem im zweiten Fall hat sie die ErwachsenenbildnerInnen vor Ort als Verbündete.
Vorkenntnisse und Lernvorgeschichte
- Nur die Hälfte der Teilnehmenden sind Anfänger in der Fremdsprache
Der Anteil der Teilnehmenden, die für die ausgewählte Fremdsprache Vorkenntnisse angeben, variiert zwischen den einzelnen Sprachen. Nur die 9 Teilnehmenden, die Tschechisch lernen, haben keinerlei Vorkenntnisse. Am anderen Ende der Skala haben beide Teilnehmenden des Arabischkurses Vorkenntnisse. Die hohen Anteile in den klassischen schulischen Erstfremdsprachen Englisch oder Französisch in den alten Bundesländern und Russisch in den neuen Bundesländern waren zu erwarten. Beträchtliche Anteile in anderen Fremdsprachen belegen noch einmal, daß auch solche Teilnehmenden in der Stichprobe zu finden sind, die die Fremdsprache schon länger lernen und mit dem Lernort Volkshochschule vertraut sind.
|
Tabelle 8: Vorkenntnisse |
|
|
Sprache |
mit Vorkenntnissen |
|
Arabisch |
100,0 |
|
Deutsch |
79,1 |
|
Russisch |
73,7 |
|
Englisch |
63,7 |
|
Französisch |
55,0 |
|
Norwegisch |
52,4 |
|
Neugriechisch |
39,5 |
|
Ungarisch |
39,5 |
|
Dänisch |
34,0 |
|
Schwedisch |
27,9 |
|
Spanisch |
23,6 |
|
Niederländisch |
19,4 |
|
Italienisch |
15,7 |
|
Türkisch |
14,8 |
|
andere Sprache |
14,3 |
|
Polnisch |
8,3 |
|
Portugiesisch |
6,3 |
|
Tschechisch |
0 |
- Mehr als 45% der Weiterlernenden lernen bereits vier Jahre oder länger
Zwar liegt der Anteil der Teilnehmenden, die die ausgewählte Fremdsprache noch nicht ein Jahr lang lernen, bei 22%. Doch den stärksten Anteil von 30% weist die Grupper derer auf, die bereits vier bis sechs Jahre die Fremdsprache lernen. Hier macht sich bemerkbar, daß in der Frage nicht zwischen schulischem Lernen und Weiterbildung unterschieden wird. Besonders hohe Anteile in dieser Lernzeit liegen bei Englisch (24,3%), Französisch (18,9%) und Russisch (31,6%). Unklar bleib außerdem, ob nicht auch teilweise die absolute Zahl der Jahre seit Lernbeginn in der Fremdsprache angegeben wird ("seit wann"), obwohl eher die Zahl der Jahre mit zusammenhängenden Lernzeiten ("wie lange") erfragt iist. Die erste Auslegung würde in Zusammenhang mit der Alterstruktur Anteile von 5% oder mehr in der Rubrik "mehr als 10 Jahre" im Sinne von Weiterlernen der schulischen Erstfremdsprachen erklären. Bei "kleinen" Fremdsprachen wie Dänisch (4,3%) und Ungarisch (5,1%) sprechen die Anteile eher für ein lebensphasenbegleitendes langfristiges Lernen. Unter Berücksichtigung der Zahl der Abiturienten verwundern die Anteile bei "mehr als 10 Jahre" in den schulischen Sprachen nicht.
- Für ein Drittel der Teilnehmenden gibt es Schulerfahrungen mit der Fremdsprache
Nicht nur bei den schulischen Erstfremdsprachen Englisch (52,1%), Französisch (38,7%) und Russisch (36,8%) spielt der Lernort Schule als Vorerfahrung eine beträchtliche Rolle. Selbst die, die jetzt Deutsch als Fremdsprache lernen, hatten im Land ihrer Muttersprache bereits Deutsch als Schulfach. Die Angaben über Lernen in Eigenregie korrespondieren mit denen zum Lernen im Land der Fremdsprache. Dies ist besonders auffällig bei Neugriechisch, Norwegisch und Ungarisch.
- Volkshochschulen die häufigsten Lernorte für Fremdsprachenlernen
Neben der Schule werden Volkshochschulen bei nahezu allen Sprachen deutlich mehr als Lernorte verwendet als andere Einrichtungen. Insgesamt werden Volkshochschulen ca. 3 mal häufiger genannt als andere Einrichtungen. Nur Arabisch, Tschechisch und Türkisch wurden bisher nicht an Volkshochschulen gelernt. Am deutlichsten ist der Vorsprung der Volkshochschulen bei Italienisch (Verhältnis 14 : 1), während er bei Englisch oder Deutsch als Fremdsprache weniger stark ausgeprägt ist (Verhältnis 2,1 : 1 bzw. 1,9 : 1).
- Fast alle Teilnehmenden rechnen mit Nachbearbeitungszeiten außerhalb der Kurse
Nur 3,7% der Teilnehmenden geben an, keine Zeit für die häusliche Nachbearbeitung des Unterrichts aufwenden zu können. Fast drei Viertel der Teilnehmenden werden es bei maximal zwei Stunden pro Woche Nachbearbeitungszeit bewenden lassen. Um einen Zusammenhang mit dem Unterricht herzustellen, wäre die Angabe über die wöchentliche Unterrichtszeit notwendig. So sagt die folgende Tabelle nichts darüber aus, ob Teilnehmende besonders hohe Nachbearbeitungszeit einplanen (können), weil sie die Sprache für besonders schwierig halten, es sich einrichten können oder weil sie eine solche Relation im Hinblick auf die Unterrichtszeit für plausibel halten. Die "großen" Sprachen Englisch und Französisch liegen eher im Durchschnitt, Italienisch und Spanisch eher darunter, Deutsch als Fremdsprache jedoch deutlich darüber. Im Fall von Tschechisch handelt es sich um Teilnehmenden lediglich aus einem Kurs, so daß sich Kursspezifitäten ausgewirkt haben können.
|
Tabelle 9: Nachbearbeitungszeit |
|
|
Sprache |
Nachbearbeitungszeit |
|
Tschechisch |
50,0 |
|
Deutsch |
49,4 |
|
Neugriechisch |
33,3 |
|
Schwedisch |
32,6 |
|
andere Sprache |
28,6 |
|
Portugiesisch |
26,7 |
|
Polnisch |
25,0 |
|
Französisch |
22,7 |
|
Englisch |
21,5 |
|
Dänisch |
20,5 |
|
Spanisch |
19,5 |
|
Türkisch |
19,2 |
|
Niederländisch |
18,9 |
|
Norwegisch |
18,2 |
|
Italienisch |
17,6 |
|
Russisch |
10,5 |
|
Ungarisch |
10,5 |
|
Arabisch |
0 |
- Ein Fünftel der Teilnehmenden verfügt über Hilfsmittel für multimediales Lernen
Häusliche Lernhilfsmittel stehen nach dem Grad ihrer Verfügbarkeit in der Rangfolge: Wörterbuch, Cassettenrecorder, CD-Player, Video und zum Schluß PC mit CD-ROM. Daß vier Fünftel der Teilnehmenden ein Wörterbuch zur gewählten Fremdsprache besitzen verwundert nicht, da bereits die Hälfte bereits Lernzeit hinter sich hat und die Aneignung eines Wörterbuchs bei Sprachinteresse zu einer der ersten Handlungen zählt. Zwei Drittel der Teilnehmenden könnten auch zu Hause das klassische Audio-Lernhilfsmittel, den Cassettenrecorder, verwenden. Ob nur zur Wiedergabe von Sprachcassetten oder auch zur Sprachkontrolle durch Aufnahmen war nicht erfragt. Ein unterdurchschnittlicher Anteil läßt sich nur bei Deutsch als Fremdsprache konstatieren. Das läßt zumindest die Vermutung zu, daß es sich bei den Nicht-muttersprachlern Deutsch um im Durchschnitt mit Unterhaltungselektronik weniger gut ausgestatteten Haushalte handelt. Dies wird durch die ebenfalls unterdurchschnittlichen Anteile der Teilnehmenden aus dieser Gruppe mit CD-Player und in noch stärkerem Maß mit PC (incl. CD-ROM) bestätigt. Noch geringer als die Nennungen von Video-Geräten fällt die Nennung von häuslichen PCs mit CD-ROM aus. Unter der Annahme, daß alle diese PCs auch mit einer Soundkarte ausgestattet sind, verfügt also jeder Fünfte Teilnehmende zu Hause über das derzeitige Standardhilfsmittel für multimediales Lernen. Diesen Zahlen wären Ergebnisse aus multimedia-bezogenen Umfragen in der Gesamtbevölkerung gegenüberzustellen.
- Zwei Drittel der Teilnehmenden sind sich über die Lernzeit im unklaren
Faßt man die Anteile der Teilnehmenden zusammen, die es vorziehen, statt eine konkrete Zeitdauer (max. 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre) zu nennen, "sich Zeit lassen" zu wollen oder keine konkreten Vorstellungen zu haben, sind es nur ein Sechstel, die mit dem Sprachenlernen kurz- oder mittelfristig einlösbare Ziele verbinden. Aus den nach konkreten Zeiten differenzierten Anteilen läßt sich kein Gipfel mit abfallenden Flanken bestimmen. Es ist allenfalls herauszulesen, daß immerhin 3% ihre Lernzeit auf höchstens ein halbes Jahr beschränken wollen und daß 5% immerhin 3 Jahre für eine plausible Lernzeit halten. Die Tatsache, daß bei Deutsch als Fremdsprache der Anteil derer, die sich "Zeit lassen" können, mit 7,7% deutlich unterdurchschnittlich ist und der Anteil derer, die ein Jahr aufwenden wollen, mit 23,1% weit über dem Durchschnitt von 5,4% liegt, spiegelt wider, wie sehr hier gesellschaftliche Außenfaktoren die kurzfristige Erreichung der Lernziele dringlich machen.
Gründe für die Wahl der Volkshochschule als Lernort
- Volkshochschulen gelten für die Hälfte der Teilnehmenden als leicht erreichbar
- Die Hälfte der Teilnehmenden kennt das Programm der Volkshochschule
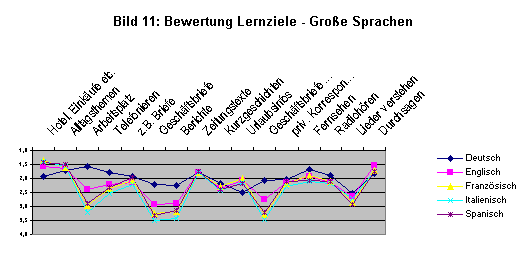
- Ein Drittel der Teilnehmenden schätzt das Preis-Leistungsverhältnis ihrer Volkshochschule
- Andere Gründe finden jeweils nur bei weniger als einem Fünftel der Teilnehmenden Zustimmung
Der Besuch eines früheren Sprachkurses, eines anderen Kurses, die Empfehlung von Bekannten, der Ruf der Sprachkurse oder eine Zeitungsnotiz werden jeweils von weniger als einem Fünftel der Teilnehmenden als Zusammenhang genannt, aus dem heraus die Entscheidung für die Volkshochschule fiel. Werbespots in Radio oder Fernsehen gab es von den 29 beteiligten Volkshochdschulen nur einmal. Demzufolge liegen die Nennungen auf der Teilnehmendenebene unter einem Prozent. Diese Frage ist deshalb nur im Hinblick auf die Erhebungseinheiten Einrichtungen interpretierbar, nicht auf die Untersuchungseinheiten Teilnehmende an Fremdsprachenkursen.
Fertigkeiten, Lernziele und Kompetenzen
- Hauptinteresse der Teilnehmenden gilt (nicht schriftbezogener) Kommunikation
Ziel der Untersuchung war festzustellen, welcher sprachlichen Fertigkeit das Hauptinteresse der Teilnehmenden gilt. Die Präsentationsform der Frage, die im Sinne eines Hauptinteresses die sich ausschließenden Alternativen "Hören und Verstehen", "Schreiben", "Lesen und Verstehen" sowie "Sprechen" zur Wahl stellte, konnte nicht verhindern, daß die Hälfte der Teilnehmenden sich für mehrere Möglichkeiten entschied. Diese Unentschiedenheit ist verständlich. Eine nachträgliche Uminterpretation der Frage als solche, die Mehrfachnennungen zuläßt, verbietet sich, da die andere Hälfte der Teilnehmenden unter dieser Annahme sich womöglich anders entschieden hätte. Insofern ist anzunehmen, daß die extrem niedrigen Anteile von Nennungen, die die schriftorientierten Fertigkeiten "Schreiben" (1,1%) und "Lesen" (3,5%) auf sich zogen, tatsächlich höher lägen, wenn Kombinationen ausgewertet werden könnten. Die Kernaussage, daß das Hauptinteresse der Teilnehmenden sich auf die nicht auf schriftliche Kommunikation ausgerichteten Fertigkeiten "Sprechen" (27,4%) und "Hören" (17,6%) richtet, bleibt auch unter dieser Einschränkung gültig.
Bei der Differenzierung nach Fremdsprachen fällt auf, daß bei vielen Fremdsprachen "Schreiben" aus Sicht der Teilnehmenden (zumindest isoliert) keine Rolle spielt. Nur bei Deutsch als Fremdsprache, das sich in der Auswertung als stärker arbeitsplatzbezogen erweisen wird, häufen sich Nennungen in überdurchschnittlicher Höhe (8,5%).
Um die Beurteilung von Lernzielen durch die Teilnehmenden zu erfassen, wurden ihnen für die Aktivitätsgruppen "Beim Sprechen", "Beim Schreiben", "Beim Lesen" und "Beim Hören" jeweils vier bis fünf Formulierungen zu Kompetenzen in Verwendungssituationen angeboten. Die Teilnehmenden waren gebeten, auf einer Viererskala zwischen "sehr wichtig", "wichtig", "nicht so wichtig" und "gar nicht wichtig" zu unterscheiden. Falls keine Entscheidung getroffen wurde, wurde das als "unentschieden" auf der Bedeutungsskala interpretiert, da eine solche Ausprägung nicht explizit vorgesehen war. Es ist außerdem ungewiß, ob die Vorstrukturierung in die genannten Aktivitätsgruppen durch den Fragebogen angebracht war. So sind beispielsweise keine Verwendungssituationen genannt, in denen nur Mischungen von Sprechen, Schreiben, Lesen oder Hören passen. Insofern ist es im Rahmen der Auswertung nur beschränkt möglich, die Antworten im Hinblick auf Verwendungszusammenhänge wie z.B. berufsbezogen zu interpretieren.
- Sprechen, Lesen und Hören im Durchschnitt wichtiger als Schreiben
Insgesamt stellt man fest, daß bezogen auf alle Teilnehmenden keine der Kompetenzen im Durchschnitt als unwichtig gesehen werden. Als besonders wichtig bewertet fallen zwei Sprechsituationen und eine Hörsituation auf, die mit Aufenthalt im fremdsprachigen Ausland zu tun haben, nämlich "Begrüßungssituationen, Hotel, Einkäufe bewältigen können", "sich an einfachen Gesprächen über Alltagsthemen beteiligen zu können" und "öffentliche Lautsprecherdurchsagen (z.B. am Flughafen) in der Fremdsprache verstehen können". Dies deckt sich mit dem hohen Anteil der Nennungen von Reisen ins fremdsprachige Ausland als Lerngrund, der schon diskutiert wurde. "Nur" neutral wurde sowohl das Schreiben als auch das Lesen von Geschäftsbriefen sowie das ähnlich gelagerte Verfassen von kurzen Berichten bewertet. Insofern kann geschlossen werden, daß der berufsbezogene Umgang mit Texten im Durchschnitt keine besondere Wichtigkeit in den Lernzielen hat. Da aber auch das Gespräch am Arbeitsplatz und das Telefonieren (leider nicht nach Kontext differenziert) keine wesentlich höheren Bewertungen erfahren, läßt sich insgesamt für den Berufsbezug konstatieren, daß er im Sinne von Durchschnitten von allen Teilnehmenden nicht überdurchschnittlich hoch ist. In der bildnerischen und tabellarischen Darstellung sind der Kürze halber charakeristische Stichworte aus den im Fragebogen (Frage 16) aufgeführten Verwendungssituationen aufgeführt. Für eine sachgerechte Interpretation steht der volle Wortlaut in dem im Anhang A abgedruckten Fragebogen zur Verfügung.
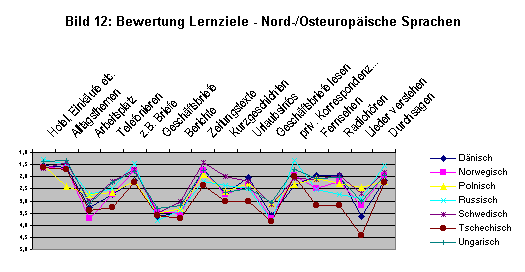
Die in der folgenden Tabelle dargestellte Rangordung (1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig) faßt die Ergebnisse für Fremdsprachenlernen allgemein zusammen. Bei Werten um 3 ("unentschieden") streuen die Beurteilungen besonders hoch. Das heißt umgekehrt, daß solche Kompetenzen Teilnehmende mit verschiedenen Sichten besonders stark trennen. Um die Bandbreiten zu verdeutlichen, sind jeweils die Sprachen aufgeführt, für die die einzelnen Bewertung am höchsten bzw. am niedrigsten waren. Deutsch als Fremdsprache findet in alltagsbezogenen Bereichen wie Fernsehen, Radiohören, Telefonieren und auch bei Geprächen am Arbeitsplatz und insbesondere bei den berufsbezogenen Lernzielen die höchsten Bewertungen, hat aber auch unentschiedenere Bewertungen z.B. bei Verständnis von Urlaubsinfos. Die soziale Integration vor allem im Arbeitsleben steht im Vordergrund. Bei Tschechisch konzentrieren sich hohe Bewertungen auf Sprechfähigkeiten bei Begrüßungssituationen - Hotel - Einkäufe bewältigen, während viele andere Kompetenzen eine geringere Rolle als in anderen Fremdsprachen spielen.
|
Tabelle 10: Bewertung von Verwendungssituationen |
||||
|
Verwendung |
Mittel |
Höchste Bewertung |
Geringste Bewertung |
Streuung |
| Hotel, Einkäufe etc. |
1,5 |
Portugiesisch 1,25 |
DAF 1,94 |
0,8 |
| Alltagsthemen |
1,6 |
Türkisch 1,15 |
Polnisch 2,40 |
0,8 |
| Lautsprecherdurchsagen |
1,7 |
Englisch 1,5 |
Tschechisch 2,25 |
0,9 |
| Zeitungstexte |
1,8 |
Schwedisch 1,41 |
Tschechisch 2,38 |
0,9 |
| Fernsehen |
2,0 |
DaF 1,68 |
Tschechisch 3,20 |
1,1 |
| Briefe usw. |
2,1 |
Russisch 1,44 |
Tschechisch 2,25 |
1,2 |
| Radiohören |
2,1 |
DaF 1,88 |
Tschechisch 3,17 |
1,1 |
| priv. Korrespondenz lesen |
2,1 |
Russisch 1,33 |
Portugiesisch 2,50 |
1,2 |
| Urlaubsinfos |
2,1 |
Türkisch 3,04 |
Französisch 2,00 |
1,1 |
| Telefonieren |
2,3 |
DaF 1,78 |
Tschechisch 3,25 |
1,3 |
| Kurzgeschichten |
2,4 |
Schwedisch 2,0 |
Tschechisch 3,00 |
1,2 |
| Arbeitsplatz |
2,6 |
DaF 1,59 |
Tschechisch 3,40 |
1,4 |
| Lieder verstehen |
2,8 |
Polnisch 2,44 |
Tschechisch 4,43 |
1,3 |
| Geschäftsbriefe lesen |
3,0 |
DaF 2,08 |
Neugriechisch 3,88 |
1,4 |
| Berichte |
3,0 |
DaF 2,26 |
Tschechisch 3,71 |
1,4 |
| Geschäftsbriefe |
3,1 |
DaF 2,22 |
Russisch 3,79 |
1,4 |
- Bewertungsprofile sehr sprachspezifisch
In der Differenzierung nach Fremdsprachen zeigt sich, daß die Bewertungen für die Kompetenzen zwar nicht allzu unterschiedlich ausfallen. Doch extreme Bewertungen fallen mehr auf, da die glättende Wirkung der Durchschnittsbildung aus großen Zahlen wegfällt. Insbesondere die Sonderstellung von Deutsch als Fremdsprache ist erkennbar. Die berufsrelevanten Kompetenzen werden durchgängig höher bewertet als in den anderen Fremdsprachen, von denen Englisch die relativ höchsten Werte im Berufsbezug einnimmt.
Bewertung didaktischer Prinzipien
- Kommunikation vor Grammatik
Teilnehmende sind in unterschiedlichem Ausmaß bereit, die angebotenen didaktischen Prinzipien
- Kommunikation Vorrang vor grammatischen Strukturen (98%)
- Unterricht ausschließlich in der Fremdsprache (92%)
- nicht ohne regelmäßige Lernfortschrittskontrolle (91%)
in ihrer Wichtigkeit zu bewerten. Generell sind die angebotenen Formulierungen nicht leicht zu durchschauen. Im ersten Fall ist eine Rangordnung zu bewerten, im zweiten Fall eine Allaussage ("ausschließlich") und im dritten Fall eine Negation mit Ausschluß ("nicht ohne"). Die Sicherheit im ersten Fall kann durch die negative Besetzung der Tätigkeit "Pauken" verursacht sein. 90% der Teilnehmenden halten dieses Prinzip mindestens für wichtig. Das Prinzip, im Unterricht ausschließlich die Fremdsprache zu verwenden, findet eine geteilte Bewertung - jeweils etwa ein Drittel halten dies für wichtig bzw. wenig wichtig. Der Anteil derer, die es für sehr wichtig halten, ist mit 19% allerdings größer als der Anteil derer, die es ablehnen (7%). Eine ähnliches Bewertungsmuster findet auch das Prinzip einer regelmäßigen Lernfortschrittskontrolle, allerdings mit einem größeren Anteil an Zustimmung.
- Über die Hälfte der Teilnehmenden ziehen Sprachenzertifikate in Erwägung
Zwar müssen Teilnehmende in den seltensten Fällen das Fremdsprachenlernen mit einer Prüfung abschließen, wie sich bei der Angabe von Belegungsanlässen bereits gezeigt hat, aber immerhin 28% haben Interesse an Zertifikaten, und weitere 26% würden sie in Erwägung ziehen. Es fällt auf, daß bei arbeitsplatzrelevanteren Sprachen wie Deutsch als Fremdsprache (54%) und Türkisch (44%) das Interessen an Zertifikaten den Durchschnitt weit überragt. In der folgenden Tabelle sind die Fremdsprachen, für die bereits Zertifkate von der WBT angeboten werden, herausgehoben und außerdem die Verwendungszusammenhänge, die am häufigsten genannt wurden, aufgeführt. Allerdings handelt es sich in vielen Fällen nicht um Häufungen in großem Abstand zu anderen Verwendungszusammenhängen.
|
Tabelle 11: Verwendung von Zertifikaten |
|||
|
Sprache |
Interesse
an einem Zertifkat
Anteil in % |
Hochgerechnet auf Belegungsgesamtzahl von 1996 | Häufigst genannte Verwendung |
| Deutsch |
54,3 |
123.871 |
Berufschancen |
| Türkisch |
44,0 |
5.293 |
Berufschancen |
| Neugriechisch |
33,3 |
5.774 |
Selbstbestätigung |
| Niederländisch |
32,4 |
4.999 |
Lernerfolgskontrolle |
| Ungarisch |
31,4 |
Nicht berechenbar |
Lernerfolgskontrolle |
| Spanisch |
29,2 |
51.165 |
Berufschancen, Lernerfolgskontrolle |
| Tschechisch |
28,6 |
Nicht berechenbar |
Selbstbestätigung |
| andere Sprache |
28,6 |
Nicht berechenbar |
Berufschancen, Lernerfolgskontrolle |
| Schwedisch |
27,9 |
4.853 |
Selbstbestätigung |
| Englisch |
26,6 |
165.781 |
Berufschancen |
| Französisch |
24,5 |
55.408 |
Berufschancen, Selbstbestätigung |
| Italienisch |
24,2 |
45.426 |
Selbstbestätigung |
| Dänisch |
20,5 |
2.590 |
Lernerfolgskontrolle, Selbstbestätigung |
| Norwegisch |
14,3 |
711 |
Berufschancen |
| Portugiesisch |
13,3 |
1.186 |
Berufschancen, Lernerfolgskontrolle |
| Russisch |
11,8 |
2.648 |
Berufschancen |
| Polnisch |
9,1 |
631 |
Berufschancen, Lernerfolgskontrolle |
| Arabisch |
0 |
0 |
Lernerfolgskontrolle |
Für eine Einrichtung wie die WBT als Prüfungszentrale geben neben den sprachspezifischen Anteilen besonders die Absolutzahlen Aufschluß über die mögliche Reichweite des Zertifikatangebots. Deswegen sind in der voranstehenden Tabelle auch aus den Anteilen mit Hilfe der Belegungsgesamtzahlen aus 1996 die Anzahl derer hochgerechnet, die Interesse an Sprachzertifikaten haben dürften. In der Summe über alle Sprachen ergibt sich ein Adressatenkreis von 470 Tsd. Menschen.
- Berufsbezogene und personenbezogene Zertifikatsinteressen halten sich die Waage
Auf Verbesserung der Berufschancen, auf Lernerfolgskontrolle und auf Selbstbestätigung richtet sich jeweils das Zertifikatsinteresse eines Fünftels der Teilnehmenden. Die Einschätzung, daß Zertifikate bei künftigen Bewerbungen konkret nutzen, haben nur 17% der Teilnehmenden, bei Deutsch als Fremdsprache, der arbeitsplatzbezogensten Fremdsprache, aber 27%. Auch der Verbesserung von Berufschancen durch Zertifikate wird in diesem Fall überdurchschnittlich häufig zugestimmt. Als Ergänzung ihres Schulabschlusses sehen Teilnehmende Zertifikate nur in 11% der Fälle.
Zusammenhänge zwischen ausgewählten Merkmalen
In diesem Abschnitt sind entsprechend dem Untersuchungsinteresse der Arbeitsgruppe "Marketing" der Prüfungszentrale Zusammenhänge zwischen ausgewählten Untersuchungsmerkmalen erörtert. Dies sind in erster Linie die Feststellung von Geschlechts- und Altersspezifitäten von Ergebnissen sowie die Prüfung auf Unterschiede bei den Teilnehmenden in den neuen und alten Ländern.
Eine Bereitstellung einer elektronischen Datenbasis für weitergehende Untersuchungen durch die Fachwissenschaft ist möglich.
Geschlechtsspezifität von Ergebnissen
- Jüngere sprachenlernende Frauen stärker vertreten als Männer
Die geschlechtsspezifischen Altersverteilungen sind ähnlich. Bei den unter 25jährigen sind Frauen stärker vertreten als Männer, dagegen sind sie bei den ab 50jährigen weniger stark vertreten.
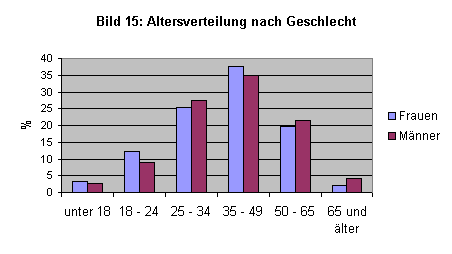
- Frauenanteil bei Teilnehmenden mit Hochschulabschluß am geringsten
Bei allen Schulabschlüssen liegt der Frauenanteil über der Hälfte und, soweit das aus Zahlen für die Gesamtbevölkerung zu entnehmen ist, 15 - 20 Prozentpunkte höher als in der Bevölkerung. Ein kontinuierlicher Verlauf ist nur auf der Teilskala von Mittlerer Reife über Abitur zu Hochschulabschluß zu erkennen, der demjenigen in der Bevölkerung entspricht: 57%, 42% und 39%, also "Je höher der Bildungsabschluß, desto niedriger der Frauenanteil". Diese Aussage kann allerdings bei Teilnehmenden von Fremdsprachenkursen nicht in den Bereich Hauptschulabschluß oder Schulabgang ohne Abschluß fortgesetzt werden. Hier muß der frauenspezifische Partizipationsgrad vergleichsweise niedriger sein. Sonst wäre jeweils ein höherer Frauenanteil zu erwarten.
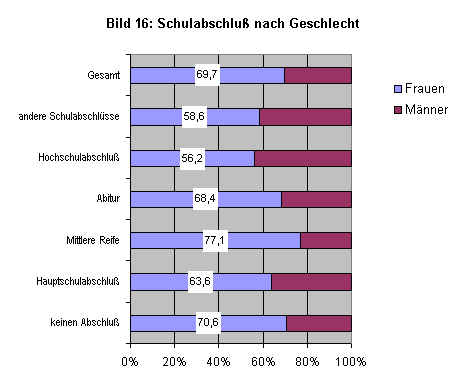
- Frauen unter den Anfängern leicht unterdurchschnittlich vertreten
Der Frauenanteil liegt bei den Teilnehmenden ohne Vorkenntnisse in der belegten Fremdsprache mit 68,0% nur wenig unter dem Frauenanteil insgesamt von 69,7%.
- Frauenanteil bei 4 bis 6 Jahren bisherige Lernzeit am höchsten
Abgesehen von den Anfängerinnen in der Fremdsprache hat der Frauenanteil bei bisherigen 4 - 6 Lernjahren einen Gipfel, mit 76,9% deutlich über dem Frauenanteil insgesamt. Er fällt in Richtung der kürzeren Lernzeiten wie auch der längeren Lernzeiten gleichmäßig auf unterdurchschnittliche Werte ab.
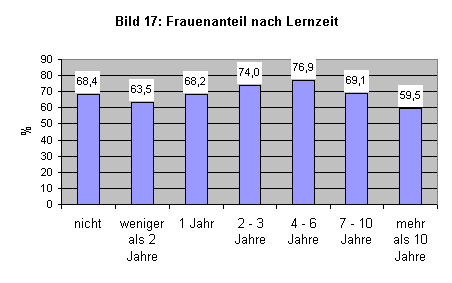
- Frauen vorsichtiger bei der Einschätzung der beabsichtigten Lernzeit
Die Vorsicht drückt sich in dem überdurchschnittlich hohen Anteil von 72,5% aus, die keine Einschätzung geben, bei gleichzeitig unterdurchschnittlichen Anteilen mit konkreter Einschätzung der beabsichtigten Lernzeit.
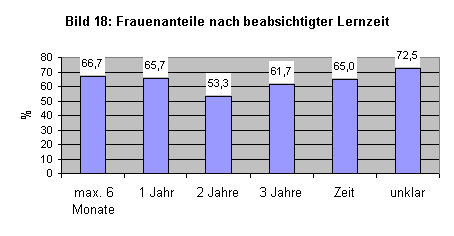
- Anlässe von Frauen für Fremdsprachenlernen stärker in sozio-kulturellen Zusammenhängen
Bezüglich aller Nennungen von Lernanlässen liegen die Frauenanteile über 50%. Die Abweichungen zwischen den Anlässen vom Frauenanteil insgesamt (ca. 70%) übersteigen eine Bandbreite von 10 Prozentpunkten mehr oder weniger nicht. Bei den Nennungen "Arbeitsplatz" ist der Frauenanteil mit 59% relativ am niedrigsten, bei "familiären Gründen" mit 77% am höchsten. Dabei bleibt offen, ob die Gründe bei Mehrsprachigkeit in Partnerschaften oder im Zusammenhang mit dem Sprachenlernen von Kindern stehen.
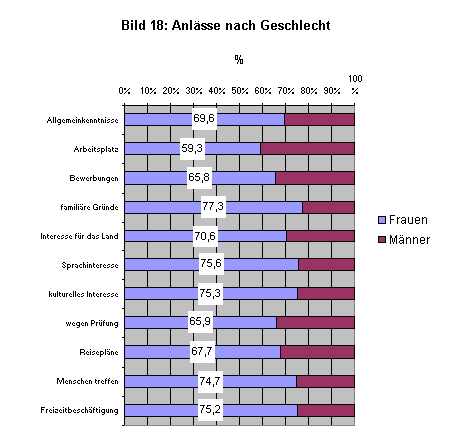
- Fast alle Lernziele sind Frauen wichtiger
Lediglich das Schreiben und Lesen von Geschäftsbriefen wird von Frauen geringer bewertet als von Männern. Dies korrespondiert mit dem relativ geringen Frauenanteil bei denjenigen, die Arbeitsplatzzusammenhänge als Lernanlaß angeben. Insgesamt sind die Unterschiede in den Bewertungen auffallend gering. Deutlich höhere Bewertungen im Vergleich zu den Männern beziehen sich nur auf insgesamt eher unentschieden bewertete Lernziele wie "kleinere Kurzgeschichten verstehen", "Urlaubsbroschüren verstehen" und "Lieder in der fremden Sprache verstehen".
|
Tabelle 12: Bewertung von Lernzielen nach Geschlecht |
|||
| Lernziele (Stichworte) | Bewertung von Frauen | Bewertung von Männern | Bei Frauenwichtiger um ... |
|
1 = sehr wichtig ... 5 = unwichtig |
|||
| Hotel, Einkäufe etc. |
1,49 |
1,61 |
0,1 |
| Alltagsthemen |
1,57 |
1,65 |
0,1 |
| Arbeitsplatz |
2,62 |
2,65 |
0,0 |
| Telefonieren |
2,26 |
2,31 |
0,0 |
| Briefe usw. |
1,99 |
2,23 |
0,2 |
| Geschäftsbriefe |
3,12 |
3,02 |
-0,1 |
| Berichte |
3,03 |
3,02 |
0,0 |
| Zeitungstexte |
1,78 |
1,80 |
0,0 |
| Kurzgeschichten |
2,26 |
2,62 |
0,4 |
| Urlaubsinfos |
2,03 |
2,42 |
0,4 |
| Geschäftsbriefe lesen |
3,01 |
2,88 |
-0,1 |
| priv. Korrespondenz lesen |
2,03 |
2,37 |
0,3 |
| Fernsehen |
1,93 |
2,04 |
0,1 |
| Radiohören |
2,10 |
2,21 |
0,1 |
| Lieder verstehen |
2,64 |
3,00 |
0,4 |
| Lautsprecherdurchsagen |
1,61 |
1,79 |
0,2 |
Altersspezifität von Ergebnissen
- Jüngeren Teilnehmenden sind Lernziele wichtiger
Die relativ höchsten Bewertungen von Lernzielen werden in 11 der 16 Fälle von den jüngeren Altersgruppen unter 25 Jahren vorgenommen. Auffallend sind die besonders hohen Bewertungen von "kleinere Kurzgeschichten verstehen" und "Urlaubsbroschüren verstehen" sowie "öffentliche Lautsprecherdurchsagen verstehen" bei den Senioren.
|
Tabelle 13: Bewertung von Lernzielen nach Alter |
||||||
| unter 18 | 18 - 24 | 25 - 34 | 35 - 49 | 50 - 65 | 65
und älter |
|
|
1 = sehr wichtig ... 5 = unwichtig |
||||||
| Hotel, Einkäufe etc. |
1,67 |
1,73 |
1,57 |
1,43 |
1,51 |
1,45 |
| Alltagsthemen |
1,59 |
1,61 |
1,56 |
1,60 |
1,60 |
1,77 |
| Arbeitsplatz |
2,33 |
2,26 |
2,45 |
2,67 |
3,21 |
3,58 |
| Telefonieren |
2,28 |
2,14 |
2,21 |
2,30 |
2,44 |
2,40 |
| Briefe usw. |
1,79 |
1,74 |
1,98 |
2,16 |
2,22 |
2,08 |
| Geschäftsbriefe |
2,94 |
2,69 |
2,98 |
3,15 |
3,58 |
3,48 |
| Berichte |
2,39 |
2,63 |
2,95 |
3,19 |
3,32 |
2,79 |
| Zeitungstexte |
1,77 |
1,65 |
1,76 |
1,85 |
1,77 |
1,78 |
| Kurzgeschichten |
2,30 |
2,22 |
2,39 |
2,45 |
2,31 |
2,04 |
| Urlaubsinfos |
2,40 |
2,40 |
2,32 |
2,05 |
1,92 |
1,75 |
| Geschäftsbriefe lesen |
2,69 |
2,59 |
2,91 |
2,99 |
3,37 |
3,31 |
| priv. Korrespondenz lesen |
2,16 |
1,76 |
2,05 |
2,24 |
2,33 |
1,98 |
| Fernsehen |
1,65 |
1,87 |
2,00 |
2,02 |
1,93 |
2,12 |
| Radiohören |
1,81 |
2,10 |
2,18 |
2,18 |
2,04 |
2,19 |
| Lieder verstehen |
2,58 |
2,71 |
2,73 |
2,73 |
2,89 |
2,93 |
| Lautsprecherdurchsagen |
1,72 |
1,70 |
1,74 |
1,66 |
1,57 |
1,47 |
Altersspezifisch erweisen sich vor allem die berufsorientierten und allgemein verwertungsorientierten Anlässe wie "Arbeitsplatz", "Bewerbungen" oder "Prüfungen". Hier sind erwartungsgemäß die jüngeren Teilnehmenden besonders stark vertreten. Überdurchschnittlich ist aber auch das Interesse der Jüngeren an den Ländern, in denen die Sprache gesprochen wird, unabhängig von Reiseplänen.
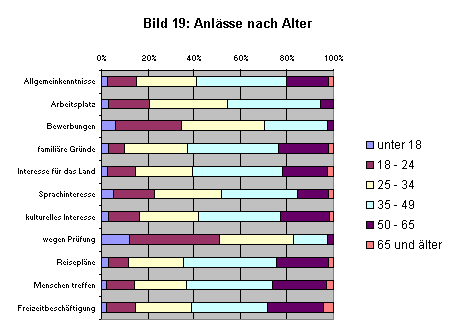
Lernvorgeschichte und Schulabschlüsse
- Je höher der Schulabschluß, desto häufiger sind Vorkenntnisse in der Fremdsprache
Erwartungsgemäß steigt mit dem weitergehenden Schulabschluß auch der Anteil der Teilnehmenden mit Vorkenntnissen in der belegten Fremdsprache. Erstaunlich ist lediglich, daß auch bei einem Drittel der Teilnehmenden ohne Abschluß Vorkenntnisse vorhanden sind bzw. daß auch bei Abitur und Hochschulabschluß der Anteil mit Vorkenntnissen nur bei 58% liegt. Dies hängt sicher damit zusammen, daß die belegte Fremdsprache häufig nicht die schulische Erst- oder Zweitsprache ist.
|
Tabelle 14 Vorkenntnisse nach Schulabschluß |
|
| Abschluß |
Anteil mit
Vorkenntnissen |
| keinen Abschluß |
32,8 |
| Hauptschulabschluß |
39,2 |
| Mittlere Reife |
52,2 |
| Abitur |
54,7 |
| Hochschulabschluß |
58,5 |
| andere Schulabschlüsse |
49,3 |
- Je höher der Schulabschluß, desto länger sind bisherige Lernzeiten
Zu allen Stufen bisheriger Lernzeiten nimmt der Anteil der Teilnehmenden in der Regel mit der Reichweite des Schulabschlusses (andere Schulabschlüsse ausgeklammert) zu. Ausnahmen sind eine besondere Wechselwirkung zwischen Teilnehmenden mit Mittlerer Reife und 4 bis 6 Lernjahren sowie bei kürzeren bisherigen Lernzeiten als 2 Jahre. Hier sind Teilnehmende mit Mittlerer Reife vergleichsweise selten. Mit der Regel korrespondiert, daß der Anfängeranteil mit steigender Reichweite des Schulabschlusses von zwei Dritteln (ohne Abschluß) auf ein Drittel (Hochschulabschluß) sinkt.
|
Tabelle 15 Bisherige Lernzeit nach Schulabschluß |
|||||||
| Abschluß | nicht | weniger als 2 Jahre | 1 Jahr | 2 - 3 Jahre | 4 - 6 Jahre | 7 - 10 Jahre | mehr als 10 Jahre |
|
In % |
|||||||
| keinen Abschluß |
66,7 |
15,9 |
4,3 |
7,2 |
2,9 |
1,4 |
1,4 |
| Hauptschulabschluß |
56,7 |
12,2 |
4,8 |
11,4 |
9,5 |
1,7 |
3,6 |
| Mittlere Reife |
45,7 |
9,6 |
4,5 |
11,8 |
20,9 |
4,8 |
2,7 |
| Abitur |
44,3 |
11,1 |
5,7 |
13,8 |
13,2 |
9,6 |
2,3 |
| Hochschulabschluß |
38,4 |
13,0 |
6,7 |
14,6 |
14,4 |
9,6 |
3,3 |
| andere Schulabschlüsse |
50,0 |
12,5 |
12,5 |
11,1 |
5,6 |
5,6 |
2,8 |
Zusammenhang bei Lernabsichten
- Ausmaß der Zeit für Nachbearbeitung und Länge der beabsichtigten Lernzeiten hängen zusammen
So häufig die Nennungen von unspezifischen Absichten zur Lernzeit auch sind, läßt sich im Zusammenhang mit Nachbearbeitungszeit doch gesichert feststellen: vor allem dienjenigen, die größzügige Lernzeiten einplanen, verfügen über längere Nachbearbeitungszeiten. Im Umkehrschluß ist bei denjenigen, die höchstens 6 Monate lernen wollen, nicht häufig mit mehr als 1 Stunde Nachbearbeitungszeit zu rechnen.
Zusammenhang von Anlässen und Zielen
- Die Prioritäten bei Lernzielen sind nahezu unabhängig vom Lernanlaß
Die in ihrer Wichtigkeit insgesamt hoch bewerteten Lernziele
- Bei Hotel, Einkäufe, etc. sprechen
- Zu Alltagsthemen sprechen
- Durchsagen verstehen
- Zeitungstexte verstehen
- Fernsehen verstehen
behalten die ersten fünf Rangplätze in der Regel auch bei Differenzierung nach Belegungsanlässen. Eine Ausnahme bilden die berufsorientierten und verwertungsorientierten Anlässe "Arbeitsplatz", "Bewerbung" und "Prüfung" und wenige weitere spezielle Anlässe:
- Beim Anlaß "Arbeitsplatz" werden die passiven Hörfertigkeiten "Fernsehen verstehen" und "Durchsagen verstehen" durch die aktiven Sprechfähigkeiten "Telefonieren" und "am Arbeitsplatz sprechen" ersetzt.
- Auch beim Anlaß "Bewerbungen" tritt an die Stelle von "Fernsehen verstehen" "am Arbeitsplatz sprechen".
- Beim Anlaß "Prüfungen" ist das Muster der fünf wichtigsten Lernziele differenzierter: die reiseorientierten "im Hotel/bei Einkäufen sprechen" und "Durchsagen verstehen" verlieren ihren Rang zugunsten von "Radio verstehen" und "am Arbeitsplatz sprechen". Damit ist noch einmal verstärkt, daß Prüfungen arbeitsplatzbezogen gesehen werden.
- Beim Anlaß "Reisepläne" spielt das "Verständnis von Urlaubsinfos" naturgemäß eine größere Rolle als "Fernsehen verstehen".
- Sowohl bei den Anlässen "familiäre Gründe" wie "kulturelles Interesse" hat "private Mitteilungen/Briefe schreiben" größere Bedeutung als "Fernsehen verstehen".
Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß abgesehen von den arbeitsplatzbezogenen Anlässen alle Anlässe auf wenige Lernziele fokussieren.
Vergleich alte und neue Länder
Aus der Kernstichprobe kommen 2098 Teilnehmende aus den alten Ländern und 768 Teilnehmende aus den neuen Ländern. Insofern haben differenzierte Aussagen eine ausreichend große Basis.
- Die häufigsten Sprachen in den alten und neuen Ländern gleich
Die Fremdsprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch sind in dieser Rangordnung die am häufigsten belegten Sprachen in den alten wie in den neuen Ländern. Allerdings sind die Anteile bei den drei romanischen Sprachen infolge der starken Konzentration auf Englisch in den neuen Ländern geringer als in den alten Ländern. In den alten Ländern folgt auf Rang 5 Deutsch als Fremdsprache mit 7,6%. Diese Fremdsprache hat in den neuen Ländern nur Rang 7 mit 1,2% der Teilnehmenden. Rang 5 ist dort mit Ungarisch in der gleichen Größenordnung wie Italienisch (1,7%) besetzt.
- Frauenanteil in den neuen Ländern geringfügig niedriger als in den alten
Die Frauenanteile liegen in den alten Ländern mit 70,1% und in den neuen Ländern mit 68,6% nur weniger als zwei Prozentpunkte auseinander.
- Teilnehmende mit einer anderen Muttersprache als Deutsch in den neuen Ländern selten
Der Großteil der untersuchten Teilnehmenden mit einer anderen Muttersprache als Deutsch besucht Kurse in den alten Bundesländern. Sein Anteil ist dort 10,6%. In den neuen Ländern macht er nur 1,8% aus.
- Teilnehmende von 35 bis unter 50 Jahren in den neuen Ländern stärker vertreten
Die Teilnehmenden in den neuen Ländern sind mit 43,0% noch stärker auf die Gruppe der 35- bis unter 50jährigen konzentriert als in den alten Ländern mit 34,1%. Dafür sind die drei jüngeren Altersgruppen, insbesondere die Gruppe der 18- bis unter 25jährigen, geringer besetzt als in den alten Ländern.
- In den neuen Ländern Teilnehmende mit Mittlerer Reife und Hochschulabschluß stärker vertreten als in den alten Ländern
Die Bildungsabschlüsse Mittlere Reife (oder vergleichbarer Abschluß) und Hochschulabschluß sind mit 44,3% bzw. 22,5% in den neuen Ländern stärker vertreten als in den alten Ländern mit 37,8% bzw. 16,0%.
- Russischkenntnisse in den neuen Ländern genauso zahlreich vorhanden wie in den alten Ländern Englischkenntnisse
Die Frage nach weiteren Fremdsprachenkenntnissen macht in der Differenzierung nach alten und neuen Ländern die Rolle der schulischen Erstsprache deutlich. Englischkenntnisse bei 55,2% der Teilnehmenden in den alten Ländern entsprechen 54,2% Russischkenntnissen in den neuen Ländern. Demgegenüber stehen nur 9,4% der Teilnehmenden mit Russischkenntnissen in den alten Ländern, aber 17,4% Englischkenntnisse in den neuen Ländern. Hier macht sich die Rolle von Englisch als schulische Zweitfremdsprache in der ehemaligen DDR bemerkbar. Diese Rolle hat in den alten Ländern Französisch, was sich in 26,7% der Teilnehmenden niederschlägt. Französischkenntnisse sind in den neuen Ländern nur bei 10,5% der Teilnehmenden vertreten.
- In den neuen Ländern telefonische Beratungsgespräche häufiger
Während die Anteile bei "Selbsteinstufung" und "anderen Belegungsgrundlagen" in Ost und West nahe beieinanderliegen, ist das Verhältnis zwischen Beratungsgesprächen und telefonischer Beratung in den neuen Ländern ausgewogen. In den alten Ländern finden im Vergleich zu telefonischen Beratungen Beratungsgespräche drei Mal so häufig statt.
- Arbeitsplatzbezogene Anlässe in den neuen Ländern häufiger
Unter den fünf wichtigsten Anlässen - solche, die mindestens in einem Viertel der Fälle genannt werden - sind vier sowohl in den alten wie in den neuen Ländern vertreten. Allerdings sind sie rangmäßig unterschiedlich plaziert. Der unspezifischste Anlaß, der Wunsch, die Allgemeinkenntnisse zu erweitern, rangiert in beiden Gebieten vorne. Der Spitzenrang ist in den neuen Ländern noch ausgeprägter. Dort folgen konkrete Reisepläne bereits an zweiter, in den alten Ländern erst an dritter Stelle, wo das diffusere allgemeine Interesse für das Land der Fremdsprache die zweite Stelle einnimmt. In den neuen Ländern kommt dies erst an fünfter Stelle. Es ist zu vermuten, daß sich hinter "Reisepläne" die aktuelle Vorbereitung verbirgt, während das Interesse für das Land als Lernanlaß sich durchaus erst als Folge von Reisen einstellen könnte. In dem Ausmaß, in dem Reisen in fremdsprachige Länder vor bzw. hinter Teilnehmenden liegen, sind erhebliche Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern sicher.
Arbeitsplatzbezogene Anlässe fehlen für die alten Länder in der Liste der fünf häufigsten Anlässe. Während sie in den neuen Ländern in 22,5% der Fälle genannt werden (zur Erinnerung: die relativ arbeitsplatznahe Fremdsprache Englisch macht über 80% der Belegungen aus), folgen sie in den alten Ländern erst auf einem niedrigeren Rangplatz mit 16,8%.
|
Tabelle 15: Wichtige Anläße in den alten und neuen Ländern |
|||
|
Anlaß |
alte Länder |
neuenLänder |
Anlaß |
| Allgemeinkenntnisse |
49,0 |
66,8 |
Allgemeinkenntnisse |
| Interesse für das Land |
41,9 |
41,1 |
Reisepläne |
| Reisepläne |
38,9 |
31,0 |
Freizeitbeschäftigung |
| Freizeitbeschäftigung |
34,7 |
22,5 |
Arbeitsplatz |
| Sprachinteresse |
28,6 |
20,1 |
Interesse für das Land |
- Bei bisherigen Lernzeiten, beabsichtigter Lernzeit und möglicher Nachbearbeitungszeit sowie bei Verfügbarkeit von Hilfsmitteln in Ost und West keine Strukturunterschiede
Allenfalls der höhere Anteil von 5,5% in den neuen Ländern (alte Länder 1,9%) für eine Lernzeit von max. 6 Monaten stützt noch einmal die größere Rolle kurzfristigerer Verwertung in Richtung Arbeitsplatz oder Reisen.
- Der Lernort Volkshochschule ist Teilnehmenden in den neuen Ländern weniger vertraut
Daß das Lernen im Lande der Fremdsprache im Rahmen der Lernvorgeschichte in den neuen Ländern mit 2,9% Nennungen seltener ist als in den alten Ländern mit 8,4%, verwundert nicht, zumal in den neuen Ländern Englisch dominiert. Der Lernort Schule wird häufiger genannt (36,3% im Vergleich zu 30,7% in den alten Ländern), aber die Volkshochschulen, die mit dem Beitritt der neuen Länder einen Funktionswandel durchgemacht haben, werden mit 9,4% seltener genannt (alte Länder: 14,4%).
- Vorerfahrungen sind als Gründe für die Volkshochschule in den neuen Ländern seltener
Nur in 13% der Fälle wird in den neuen Ländern ein früherer Sprachkurs und in 10,9% der Fälle ein anderer Kurs als Argument für die Volkshochschule benannt. Daß der Anteil der Belegungen an Volkshochschulen in den neuen Ländern an der Bevölkerungszahl zur Zeit geringer ist als in den alten Ländern, weiß man bereits aus der allgemeinen Volkshochschul-Statistik. Insofern ist der Befund erklärlich.
In den neuen Ländern ist die Dominanz der Informationen aus Programmheften/-broschüren der Volkshochschule über Informationen in Zeitungen nicht so ausgeprägt: neue Länder 2,5fach - alte Länder 9fach. Bezogen auf Programmhefte/-broschüren könnte sich hieraus eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit ergeben, es sei denn, Zeitungen spielten generell als Infortmationsmedium in den neuen Ländern eine erheblich größere Rolle.
- Hörfähigkeiten in den neuen Ländern wichtiger als Sprechfertigkeiten
Während in den alten Ländern Sprechfertigkeiten (29,6%) gegenüber Hörfähigkeiten (16,0%) deutlich höher eingeschätzt werden, haben sie in den neuen Ländern mit 21,5% bzw. 22,0% eine ausgewogenere Bedeutung. Hier ist wieder zu berücksichtigen, daß in den neuen Ländern eine starke Konzentration auf Englisch vorliegt, während sich die Teilnehmenden in den alten Ländern gleichmäßiger auf "große" und "kleine" Sprachen verteilen.
- Rangordnung "Verständigung vor Grammatik" in den neuen Ländern noch deutlicher
Dieses didaktische Prinzip bewerten 57,9% in den neuen Ländern (alte Länder 52,8%) als sehr wichtig. Bei der Notwendigkeit von kleineren Tests und der Durchführung des Unterrichts ausschließlich in der Fremdsprache sind die Bewertungen der Wichtigkeit in den neuen Ländern weniger entschieden.
- Der Wunsch nach Zertifikaten in Ost und West gleichstark ausgeprägt
Daher sind die Unterschiede in der Einschätzung der Verwertung von Zertifikaten von Interesse. Der Rolle der Sprachprüfungen an den Volkshochschulen der ehemaligen DDR entspricht es, wenn der Ergänzungsaspekt zur Schule in den neuen Ländern (13,7%) häufiger genannt wird als in den alten Ländern (10,0%). Dies kann aber allein schon durch die besondere Rolle von Englisch erklärt werden.
Deutlich ist die geringere Bewertung von interner Verwertung von Zertifikaten allgemein zur Lernerfolgskontrolle in den neuen Ländern (17,6%; alte Länder 22,7%).
Aus der größeren Rolle, die arbeitsplatzorientierte Anlässe in den neuen Ländern spielen, wäre eine stärkere Nennung von arbeitsplatzbezogener Verwertung von Zertifikaten zu erwarten gewesen. Hier gibt es aber keine bemerkenswerte Unterschiede zwischen den alten und den neuen Ländern.
- Pehl, Klaus: Zum Stand der Beruflichen Bildung an Volkshochschulen - Quantitative Aspekte. Unveröffentlichtes Manuskript. DIE 1995
- Pehl, Klaus; Reitz, Gerhard (Zusammenstellung): Volkshochschul-Statistik. 34. Folge, Arbeitsjahr 1995. Frankfurt am Main. DIE 1996
- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 1997 für die Bundesrepublik Deutschland. Metzler-Poeschel. Stuttgart 1997
- Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hrsg.): Berichtssystem Weiterbildung VI. Integrierter Gesamtbericht zur Weiterbildungssituation in Deutschland. Bonn 1996
Anhänge
Anhang 1: Befragung neuer TeilnehmerInnen an VHS-Sprachkursen. Hinweise zur lokalen Grundauswertung
Anhang 2: Fragebogen - Beteiligungsquoten
Anhang 3: Untersuchung Sprachkursteilnehmende an VHS 1997. Bundesweite Kernstichprobe
Klaus
Pehl: Neue
TeilnehmerInnen an Volkshochschul-Sprachkursen 1997. Auswertung einer Befragung.
Abschlußbericht. Online im Internet – URL: http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1998/pehl98_02.htm
Dokument aus dem Internet-Service
des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e. V. – http://www.die-frankfurt.de/esprid